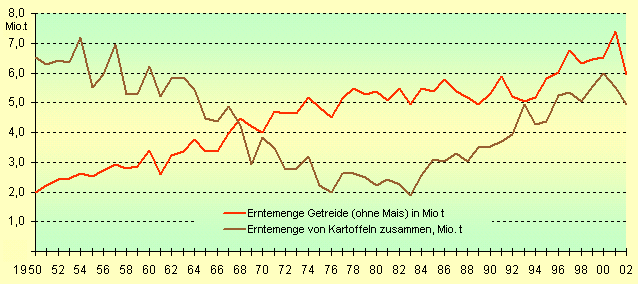
(Anbau und Ernte 2002 in Niedersachsen, Ergebnisse der amtlichen Erntestatistik)
Datengrundlage
In dem Artikel sind die vom niedersächsischen Landesamt für
Statistik ermittelten Ernteergebnisse 2002 dargestellt. Wie die Ergebnisse
ermittelt werden, lesen Sie in dem Artikel: Die
Ermittlung der amtlichen Hektarerträge für Feldfrüchte in
Niedersachsen und Ernteergebnisse 2001.
Was vom Erntejahr 2002 in Erinnerung bleiben wird, sind schlechte Erträge und viele Unwetter. Die Ernte 2002 brachte den niedersächsischen Landwirten deutlich weniger Einnahmen aus dem Verkauf von Feldfrüchten als die Ernte des Vorjahres. Dabei gibt es natürlich wieder Unterschiede zwischen den einzelnen Früchten und Regionen.
| Grafik 1: Ernte von Getreide und Kartoffeln in Niedersachsen seit 1950 in Mio. Tonnen |
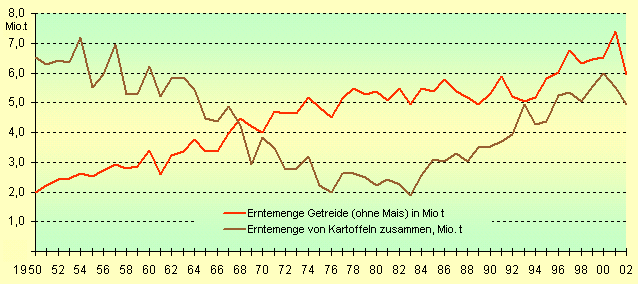 |
Es fing im Mai mit einer mageren Spargelernte an und setzte sich zu den folgenden Ernteterminen für die Mehrzahl der angebauten Früchte so fort. Lediglich für Mais, Grünland, Rüben und einzelne Gemüsearten waren gute bis befriedigende Ergebnisse zu verzeichnen. Von den Früchten des Acker- und Grünlandes wurde im Durchschnitt 11% weniger Menge als im Vorjahr eingefahren. Vom Getreide wurde gegenüber 2001 20% weniger eingelagert, bei Kartoffeln 11% weniger, Raps -6%, Spargel -18%, Erdbeeren -14%, Äpfel -47%, Süßkirschen -61%, usw.
Es gibt nur eine Minderheit von landwirtschaftlichen Betrieben, die 2002 mehr ernten durften. Das waren Betriebe in Gegenden und mit Früchten, die sonst eher mit Wassermangel zu kämpfen haben. Die hauptsächlich auf leichten Böden angebaute, aus dem tropischen Mittel- und Südamerika stammende Maispflanze fühlte sich z.B. während des feucht-warmen Sommers sehr wohl und konnte in der Form des Körnermaises als einzige unter den größeren Ackerfrüchten im Hektarertrag gegenüber dem Vorjahr sogar bescheiden um 0,8% (0,7 dt/ha) zulegen. Im Tabellenteil dieses Artikels sind die Erbenisse der einzelnen Bereiche als pdf-Dateien gespeichert. Die pdf-Dateien werden in einem separaten Browserfenster geöffnet, wenn Sie den Arcobat-Reader installiert haben. Mit dem "X"- Knopf (löschen) kommen Sie dann wieder auf diese Seite zurück.
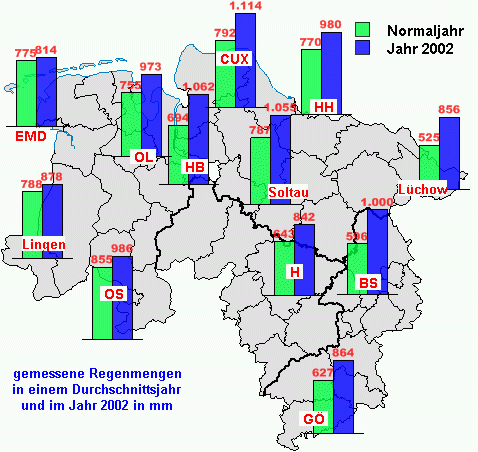 |
| Weit überdurchschnittliche Regenmengen 2002 im sonst eher trockenen östlichen Niedersachsen. |
Schuld an den Mindererträgen sind hauptsächlich die Rekordniederschläge
mit dem Mehrfachen der sonst üblichen Niederschlagsmengen im September
2001, Februar und Juli 2002 (vgl. Link Wettergrafiken, Grafik 1). Der nasse September 2001 behinderte
die pünktliche und sorgfältige Bestellung des Wintergetreides
für die Ernte 2002. Ebenso der nasse Februar 2002 die Bestellungsarbeiten
der Sommerungen im März. Ausgerechnet zur Obstbaumblüte sorgten
Spätfröste und eine bienenunfreundliche Kälte und Nässe
für eine schlechte Obsternte (vgl. Link Wettergrafiken, Grafik 1 bis 4).
Sonst standen Frühjahr und Sommer
2002 schon vor den Überschwemmungen im Juli im Zeichen einer feucht-warmen
Witterung mit erheblichen Unwetterschäden und sich in fast allen Kulturen
rasant ausbreitenden Pilzkrankheiten. Der Juni 2002 war mit 16,8°C
durchschnittlicher Tagesmitteltemperatur 2,7°C wärmer als der
regnerisch-kalte Juni 2001 und 1,5°C wärmer als im langjährigen
Mittel! Es war keine trockene, sonnige Hitzeperiode sondern es war überwiegend
bedeckt und es kam immer wieder zu zum Teil heftigen Schauern. Ein feucht-warmes
Treibhausklima fördert das Massenwachstum, aber zugleich auch die
Ausbreitung von Pilzinfektionen. Sturm und Unwetter im Juli verursachten
viel Lagergetreide und schnitten die Wurzeln oft von der Luftversorung
ab. Insgesamt hatten grundwassernahe Böden oft mit stauender Nässe
und flußnahe Standorte mit Hochwassern zu kämpfen. Die Drainage- und Abflußsystem im östlichen Niedersachsen sind auf diese Regenmengen nicht ausgelegt.
Hier muß das Land regional unterteilt betrachtet werden. Besonders betroffen von den Ertragsverlusten war der Raum zwischen Harz und Elbe sowie die Marschen und Niederungen. Im Süden und Westen des Landes reichte es meist noch für Durchschnittsernten. Das zeigte sich auch in den Ergebnissen der Kammergebiete. Für das Kammergebiet Hannover wurde für die Früchte auf dem Ackerland und Grünland im Schnitt 14% weniger Erntemenge als im Vorjahr ermittelt, für das Kammergebiet Weser-Ems (westliches Niedersachsen) nur -6%. Aber auch innerhalb dieser Gebiete und natürlich von Betrieb zu Betrieb gab es Abstufungen. Sonst sehr trockene, höherliegende Standorte waren von der ständigen Staunässe und den Überschwemmungen weniger betroffen als Betriebe mit vielen Feldern in Fluss-, Küsten- und Moorniederungen.
| Grafik 2: Getreideernte nach Kammergebieten |
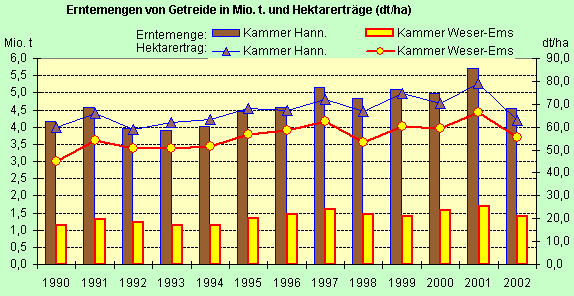 |
| Die Hektarerträge und Erntemengen im Kammergebiet Hannover sanken stärker als im Kammergebiet Weser-Ems. In der Grafik gezeigt am Beispiel des Getreides zusammen. |
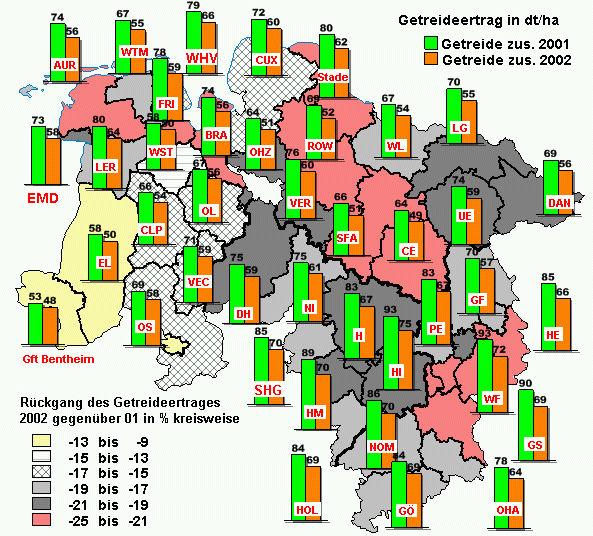 |
| Weit überdurchschnittliche Ertragsverluste im östlichen Niedersachsen und in den Niederungen. Getreide zusammen = Durchschnittswert aller Getreidearten ohne Mais. |
Die schlechte Getreideernte 2002 kam unerwartet. Noch Ende Juni ließen die üppigen Bestände wieder auf eine hohe Ernte hoffen. Die erste Vorschätzung der Getreideernte Ende Juni war noch recht optimistisch. Doch dann knickte ein Sturm am 10. Juli die meisten Getreideschläge zwischen Harz und Elbe um.
 |
| Die üppigen Bestände ließen Ende Juni eine Rekord-Ernteerwartung aufkommen. Hier in Schickelsheim am 28.06.02. Im Hintergrund der Kaiserdom von Königslutter am Elm. |
 |
| Für das Kammergebiet Hanover 2002 typischer Lagerschaden nach dem Sturm am 10.Juli 2002. Weizen bei Ronnenberg (Krs. Hannover) am 11.07.02. |
Nach Sturm, Regen, Hagel am 10. Juli trafen den Raum zwischen Harz und
Elbe am 17. und 18. Juli extreme Niederschläge. Während es im
Westen zu der Zeit zu keinen Unwetterverlusten kam, waren die Verluste
nördlich von Solling und Harz bis zur Elbe erheblich, besonders extrem
natürlich in den überschwemmten Tallagen. Der Sturm am 10. Juli
walzte einen Großteil der Getreideflächen platt, unterbrach
die Leitungsbahnen in den Halmen und führte über sehr kleine
Körner zu geringen Erträgen. Die nachfolgende Nässe führte
noch zusätzlich zu erheblichen Qualitätsverlusten durch Auswuchs
und Pilzbefall.
Die heftigen Regenfälle im Juli 2002 stammten von Tiefs, die vom
Atlantik her ungewöhnlich weit in den Süden drifteten, südlich
an den Alpen vorbei in das Mittelmeer. Über dem Golf von Genua und
der Adria hatte sich die Luft erwärmt und dabei riesige Mengen Mittelmeerwasser
aufgesogen (Tiefdruckgebiete füllen sich auf, saugen Bodenluft an).
Dem Drall der Tiefs folgend, prallt eine solche mit Feuchtigkeit schwer
beladene Luft dann irgendwann gegen die Alpen oder umgeht sie über
Niederösterreich nach Norden. Hier kühlt sie sich auf dem Weg
irgendwo ab und verliert dabei ihre ungeheuere Wasserfracht. Ungewohnterweise
aus dem Südosten einziehende Starkniederschläge, die irgendwann
zwischen Ungarn und der Weser zum Stehen kommen, können bei solchen
Tiefdruckarten die Folge sein. Am 17./18. Juli regnete sich ein solches
Tief über dem Kammergebiet Hannover aus. Das weiter westliche Kammergebiet
Weser-Ems blieb deswegen von den Juliüberschwemmungen durch die "Fünf-B-Tiefs"
aus dem Südosten verschont. Der Meteorloge W. J. van Bebber hat sich
im vorletzten Jahrhundert der Mühe unterzogen, die Zugbahnen der atlantischen
Tiefdruckgebiete über Europa zu klassifizieren. Er hat diese südliche
Zugbahn als V-b ("Fünf-b") Zugbahn bezeichnet.
Siehe auch Meldung der Rheinische
Post am 18.07.2002.
 |
 |
| In den dichten Matten auf den Böden hielt sich die Feuchtigkeit. Die kleinen Körner wuchsen in den unteren Ähren teilweise aus und spitzten mit den Blattspitzen aus den Matten. Schob man die obere Lage etwas zur Seite, konnte man den Schaden sehen. Bilder von M. Rode aus einem Weizenfeld bei Coppenbrügge, Kreis Hameln am 14.08.2002. | |
Die Ertragsrückgänge gegenüber dem sehr guten Vorjahr nur
den Unwettern im Juli und den Folgen anzulasten, ist bequem, stimmt aber
nicht ganz. Zweifellos sind die Unwetterfolgen für einen Großteil
der Mengenverluste im Landesdurchschnitt verantwortlich, aber z. B. die
Kornbildung der Wintergerste war von den Unwettern nicht mehr betroffen
und trotzdem lag der Ertrag überall, auch auf den vor den Unwettern
gedroschenen Feldern, sehr weit unter den Erwartungen.
Die Landwirte im Kammergebiet Weser-Ems sind von den Juliunwettern wenig
betroffen worden und konnten trotzdem nicht einmal eine Durchschnittsernte
einfahren. In den südlichen Kreisen Northeim und Göttingen blieb
die Mehrzahl der Schläge stehen. Trotzdem haben diese ungeschädigten
Felder ebenfalls überraschend niedrige Erträge mit geringen Einzelkorngewichten
(vgl. Kreistabellen).
| Grafik 3: Hektarerträge (dt/ha) für die anbaustärksten Getreidearten in Niedersachsen seit 1950 |
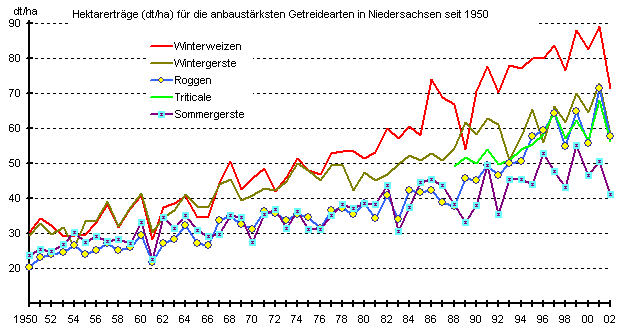 |
| Der mehr als deutliche Rückgang der Hektarerträge hatte eine Reihe von - je nach Region unterschiedlich gewichtigen - Gründen. |
Die unerwartete Ertragsschwäche im ganzen Land könnte an einem je nach Getreideart, Standort und Bestandesführung verschiedenen Ursachen-Mix gelegen haben:
 |
| Dass die Lagerschäden in den Sturmzentren nichts mit der Düngung zu tun hatten, zeigte sich auf den Parzellen der Sortenversuche. Der Sturm warf später auch die dünnen, ungedüngten Parzellen zu Boden. (Bilder aus Schickelsheim, Feldtag der Kammer Hannover, 28.06.02) |
Die Hauptgetreidearten und der Raps reagierten unterschiedlich auf die geschilderten Bedingungen. Vielfach wurden folgende Beobachtungen gemacht:
Kleinkörnige Wintergerste
Das flache, wassergeschädigte Wurzelwerk der Wintergerste hielt die kurze Trockenheit Ende Juni meist nicht aus und das führte, zusammen mit dauernden Pilzinfektionen, zu einer besonders plötzlichen Reife und damit zu kleinen Körnern und geringen Erträgen.
Rapsertrag blieb teilweise auf den Feldern
Gegenüber der Junimeldung 2002 wurde der Winterrapsertrag in den späteren Meldungen um 6 dt/ha (-18%) reduziert, was nicht nur an den eingetretenen Kornverlusten, Auswuchs und der mangelnden Kornfülle nach den Stürmen und Dauerregenfällen gelegen haben dürfte. Auch hier wurden selbst aus Gebieten mit wenig Sturmschäden, z.B. dem Eichsfeld, überraschend niedrige Erträge gemeldet (vgl. Kreistabellen). Die durchweg sehr kleinen Körner könnten ihre Ursache ebenfalls in einer starken, nicht immer sofort sichtbaren Schädigung der Pflanzen durch PiIzkrankheiten gehabt haben. Im Jahresvergleich ist dieses Jahr trotz der Flächenausdehnung um +24% wegen der geringen Hektarerträge weniger Raps als 2001 geerntet worden.
Gute, aber wenig Braugerste
Die sehr dünnen, lichten Sommergerstenbestände auf den Sandböden, z.B. die Braugersten in der Heide, haben dieses Jahr gute Vollgerstenanteile, hervorragende Qualitäten (ein etwaiger Reststickstoff zur Eiweißeinlagerung am Schluss der Kornfüllungsphase war für die Wurzeln nicht mehr erreichbar), doch miserable Erträge.
Roggen und Triticale verloren nach der Reife auf den Feldern täglich an Wert
Roggen und Triticale sind nicht so anfällig für Pilzkrankheiten. Sie hatten 2002 von den Hauptgetreidearten, trotz der Überschwemmungen in den Tallagen zwischen Weser und Elbe, die geringsten Ertragsrückgänge (vgl. Landestabelle), aber dafür die größten Auswuchs- und damit Qualitätsprobleme. Roggen und Triticale werden bevorzugt auf leichteren Böden angebaut. Hier konnte auch im extrem nassen Herbst und Frühjahr das Wasser eher versickern und es früher auch mal in den Beständen trocken werden. So wurde den Pilzkrankheiten, die bei hoher Feuchtigkeit und Wärme kaum zu stoppen sind, der Angriff wenigstens manchmal etwas erschwert.
Die Hauptmenge des Roggens und der Triticale konnte wegen nasser Felder und ständig den Einsatz der Mähdrescher störender Regenfälle nach der Reife nicht sofort geerntet werden, kam wegen der feuchtwarmen Witterung in Keimstimmung und verlor die Qualität. Wenn Getreide auswächst, also Keimwurzeln und den Keimling entwickelt, verliert das Korn zuerst an Qualität und dann auch noch Gewicht, wenn es wieder getrocknet und gedroschen wird. Die Elbmarschen und die Heide, der Roggen und die Triticale, sind von Qualitätsverlusten noch stärker als der Weizen in der Börde betroffen.
Winterweizen mit kleinen Körner, geringen Erträgen und Qualitäten
Durch die hohen Lagerschäden in der Börde, um die Börde herum und in den Elbmarschen mußten die Hoffnungen auf eine gute Ernte ab dem 10. Juli 2002 aufgeben werden. In den Seemarschen insgesamt (von der Ems bis zur Elbe) kommen noch die Strukturprobleme und Nässeschäden durch den zu nassen Herbst 2001 hinzu. Auch in den weniger durch die Herbstnässe 2001 und die Unwetter im Juli 2002 geschädigten Gebieten ist die Weizenernte enttäuschend. Das schwach entwickelte Wurzelwerk, dauernder Angriff von Pilzkrankheiten, Lagerschäden, Auswuchs, Unkrautdurchwuchs, alles wirkte auf sehr geringe Korngrößen hin.
Es gab beim Auswuchs Unterschiede, je nachdem wie das Getreide lag,
wie feucht der Boden darunter war und natürlich Unterschiede in den
Sorten und bei den Getreidearten. In der Börde war die Mehrzahl der
Felder schon beim Sturm am 10. Juli umgefallen und hier lag z.B. der Weizen
exakt wie in eine Richtung gekämmt am Boden. Die Ähren lagen
oben auf, konnten sich evtl. sogar wieder etwas aufbiegen. Es gibt solche
Bestände, die brauchbare Fallzahlen liefern. Die kleinen Körner
hatten gute Eiweißwerte. Große Hoffnung auf ausreichende Backqualitäten
bestanden aber auch hier insgesamt nicht. Die Leute an den Sieben mußten
viel Kleinstkorn absacken. Bestände, die erst durch den Starkregen
am 17./18. Juli in den Boden gedrückt worden sind, hier vor allem
in den Elbmarschen und in der Heide, lagen kreuz und quer mit Haufenbildung.
In den Haufen wuchsen die Körner in den verschütteten Ähren
aus. Hier wurden keine Backqualitäten mehr erzielt.
 |
| Weizendrusch am 16.08.02 bei Meensen (Krs. Göttingen) mit Gausturm auf dem Hohen Hagen im Hintergrund. |
 |
| Kartoffelernte am 12.09.02 bei Hannover |
Ein rentabler Kartoffelanbau verlangt hohe Erträge, denn nur so lassen sich die hohen Fixkosten dieser Intensivfrucht je Doppelzentner gering halten. Hohe Erträge werden aber nur erreicht, wenn die Bestände lange gesund und am wachsen gehalten werden können. Ohne Behandlungen gegen die Pilzkrankheit "Kraut- und Knollenfäule" würden die Bestände in der Regel schon mitten im Sommer zusammenbrechen. Die feucht-warme Witterung des Sommers förderte die Ausbreitung der Pilzkrankheiten extrem. Wer nun wegen hoher Grundwasserstände Schwierigkeiten hatte in die Felder zu fahren, für den waren hohe Erträge nicht mehr erreichbar. Hier zeigte sich wieder ein Vorteil der leichten, schneller abtrocknenden Sandböden für den Kartoffelanbau.
Die Kartoffelhektarerträge sanken nicht so stark wie die Getreideerträge.
Während im Weser-Ems-Gebiet noch Knollenerträge im Mittel der
letzten sechs Jahre geerntet wurden, wurden im Kammergebiet Hannover auch
die langjährigen Erträge im Mittel um 7% verfehlt. Gegenüber
dem sehr guten Vorjahr wurde eine um ca. 10,5% geringeren Erntemenge eingelagert.
Der schöne Spätsommer hatte die Ernte erleichtert. Die Knollen,
die während der "Hochwassersaison" im Juli und Anfang August tiefer
in den Dämmen "ertrunken" sind, hatten sich bis zur Ernte im September
zersetzt und behinderten die Erntearbeiten wenig. Auffallend war der hohe
Anteil von Knollen mit grünen Stellen. Durch die Platzregen im Juli
wurde Erde von den Dämmen geschwemmt und manche Knollen freigelegt.
Wenn die Knollen ans Licht kommen, bekommen sie grüne Stellen, mußten
aufwändig aussortiert werden.
| Grafik 4: Die Hektarerträge und Erntemengen an Kartoffeln in den Kammergebieten ab 1990 |
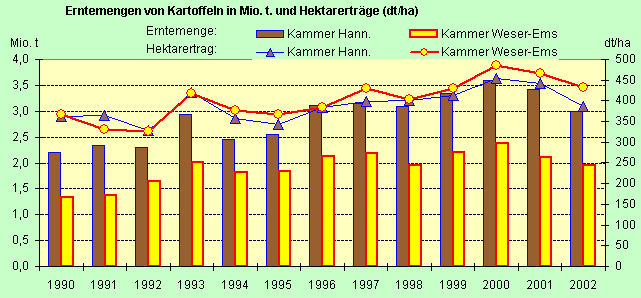 |
Nach den Wetterkapriolen vom September 2001 bis August 2002 erfüllte das Wetter im Spätsommer und bis Mitte Oktober 2002 die Anforderungen an eine materialschonende Hackfruchternte und eine befriedigende Herbstbestellung. Nach der enttäuschenden Getreideernte war man etwas pessimistisch bezüglich der Rübenerträge, die sich aber im Oktober auf ein noch gutes Niveau einpendelten. Durch nässegeschädigte Gegenden und Felder schwankten die Erträge von Feld zu Feld und Region zu Region stärker als in den Vorjahren. In den Infoschreiben für die Ernte- und Betriebsberichterstatter des niedersächsichen Landesamtes für Statistik, Info 10/2002, endgültige Kreiserträge für Zuckerrüben und Info 12/2002, Meldungen der Zuckerfabriken wird näher auf die Regionalerträge eingegangen. Der milde Spätsommer hatte den Rübenertrag noch sehr gefördert. Ab der 42. Woche behinderten Niederschläge die Rübenernte und eine befriedigende Weizenbestellung. Die der Ernte folgende Herbstbestellung erforderte 2002 sehr hohe Zugkräfte, da die Böden durch die starken Niederschläge sehr dicht lagerten und sich entsprechend zäh in ein feines Saatbett für die Körner verwandeln ließen.
 |
| Grünlandhof im "Nassen Dreieck" (Weser-Elbe-Mündung) im Spätherbst 2002 |
Der erste Grünlandschnitt Ende Mai konnte noch einigermaßen
problemfrei eingebracht werden, doch schon beim 2. Schnitt Ende Juni/Anfang
Juli hatte nur der Glück, der vor den großen Niederschlägen
Mitte Juli die Wiesen geräumt hatte. Grünlandaufwuchs hätte
es in diesem regenreichen, relativ warmen Jahr genug gegeben, wenn man
es denn alles hätte bergen oder abweiden können. Das Grünland
in Niedersachsen ist konzentriert auf die Tieflagen mit ständigen
Befahrbarkeitsproblemen bei hohen Grundwasser/Flußwasserständen.
Die häufigen Überschwemmungen in den Niederungen machten eine
Bergung zur Glückssache. Es war nicht immer möglich, diese Lagen
zu beernten. Das etwas höher gelegene Grünland brachte gute Erträge.
Im Herbst ermöglichte der anfangs überwiegend sonnige Oktober
weitgehend den Abschluß der Ernte-, Pflege- und Bestellarbeiten auf
Acker- und Grünland.
 |
| Kraniche in einem nur teilweise abgeernteten Maisfeld im Großen Moor bei Uchte, 19. März 2003 |
Die Maisernte insgesamt war gut, auch wenn durch die überraschend plötzliche Abreife des Silomaises etliche Silage wohl zu spät, das heißt zu trocken, in die Fahrsilos kam. Eigentlich sollte die Pflanze noch etwas grün sein, um die Verdaulichkeit im Rindermagen zu verbessern. Dafür freuten sich die Körnermaisanbauer über relativ geringe Kornverluste, schön ausgereifte Körner und eine schnelle Nachtrocknung der Ware. Die Ernte war Mitte Oktober schon weitgehend abgeschlossen, da der Mais durch den relativ warmen Sommer 2002 in der Reife ca. 14 Tage Vorsprung hatte. Das feucht- warme Wetter hat der aus dem tropischen Mittel- und Südamerika stammenden Maispflanze gut getan. Durch die hohen Niederschläge im Juli hatten sich Nährstoffe in tiefere Bodenschichten verlagert und die Maispflanze hatte zum Vegetationsende hin Versorgungsschwierigkeiten, was eine schnelle Abreife beschleunigte. Im Kammergebiet Weser-Ems war die Maisernte, bis auf die zu nassen Stücke, gut. Im Kammergebiet Hannover wurden während der Starkregenfälle im Juli doch mehr Nährstoffe als erwartet verlagert. Man hatte sich hier auf den leichten Böden eigentlich etwas mehr erwartet.
Der niedersächsiche Marktobstanbau konzentriert sich am Südufer der Niederelbe in den Kreisen Stade, Harburg und Cuxhaven. Hier befinden sich 95% der Apfelflächen, 89% der Süßkirschenflächen der niedersächsichen Marktobstbetriebe, 40% der Sauerkirschenfläche und 84% der Pflaumen/Zwetschenfläche. Das "Alte Land" zwischen Hamburg-Finkenwerder und Stade ist vom Obstanbau geprägt. Die Konzentration des niedersächsischen Obstanbaues auf die Elbmarschen hatte dieses Jahr fatale Folgen. Klima- und Hochwasserstandsschäden in den Marschen konnten nicht durch bessere Ernten in anderen Lagen ausgeglichen werden. Es kam zu drastischen Mengeneinbrüchen (vgl. Tabellenteil). Ein Teil der Mengenveränderungen ist auf geänderte Flächenzahlen zurückzuführen (vgl. die hier folgenden Tabellen 4 u. 5). 2002 gab es wieder eine nur alle fünf Jahre durchgeführte Obstanbauerhebung. Es wurden die Betriebe mit Marktobsterzeugung im Land gezählt und auch deren Anbau. Die Ergebnisse, insbesondere die Anbauflächen, sind mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar, da es zu einigen methodischen Änderungen kam (Mindesterfassungsgrenzen der Betriebe u.a.). Der Trend zu Dichtpflanzen besteht weiter, es gibt mehr Bäume auf tendenziell weniger Fläche.
Spätfröste und schlechtes Wetter zur Obstbaumblüte
Während des in Norddeutschland überwiegend milden und nassen Winters 2001/2002 kam es zu keinen oder nur geringen Frostschäden an den Obstgehölzen. In der 5. Woche lagen die Temperaturen um bis zu 9,5°C über den langjährigen Werten! Hohe Durchschnittstemperaturen im Februar und März verleiteten die Obstbäume allerdings zu einer frühen Blüte (vgl. Tab. 1). Einzelne Kirschbäume früher Sorten blühten schon Anfang April.
| Baum | Langjährige Blühtermine ** | Blühtermine 2002 | ||||
| Blühbeginn | Vollblüte | Blühende | Blühbeginn | Vollblüte | Blühende | |
| Süßkirschen | 23. April | 2. Mai | 8. Mai | 11. April | 21. April | 9. Mai |
| Äpfel | 5. Mai | 15. Mai | 23. Mai | 24. April | 5. Mai | 17. Mai |
* Quelle: Obstbauversuchsanstalt der Landwirtschaftskammer Hannover in Jork, ** Mittelwerte der Jahre 1933/34 bis 1996
Leider schadete dieser Vegetationsvorsprung den Obstbaumblüten. Vom 5. bis 10. April kam es zu starken Nachtfrösten (vgl. Link Wettergrafiken, Grafik 4). Die Temperaturen waren so tief und anhaltend, dass auch die meist noch geschlossenen Blüten teilweise erfroren. Je weiter sich eine Obstbaumblüte öffnet, um so frostanfälliger wird sie. Die Frostschutzberegnungen in vielen Marktobstplantagen an der Niederelbe kamen zum Einsatz. Trotzdem erlitten nach den Schätzungen der Berichterstatter z. B. rund 30% der Kirschbäume mittlere bis große Frostschäden an den Blüten (vgl. Tab. 2). Dann folgte bis Anfang Mai meist ein kühles, feuchtes und windiges Wetter. Der Bienenflug und damit die Befruchtung der Blüten waren deswegen schlechter als in den Vorjahren. Die Berichterstatter beurteilten dieses Jahr den Insektenflug zur Obstbaumblüte mehrheitlich als unzureichend (vgl. Tab. 3).
| Obstart | Frostschäden an der Blüte der Obstbäume im Marktobstanbau 2002 bis 1998 | |||||||||||||||||||
| groß | mittel | gering | keine | |||||||||||||||||
| ‘02 | ‘01 | ‘00 | ‘99 | ‘98 | ‘02 | ‘01 | ‘00 | ‘99 | ‘98 | ‘02 | ‘01 | ‘00 | ‘99 | ‘98 | ‘02 | ‘01 | ‘00 | ‘99 | ‘98 | |
| % der Meldungen der Berichterstatter | ||||||||||||||||||||
| Äpfel | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 19 | 8 | 8 | 5 | 8 | 13 | 14 | 7 | 21 | 7 | 60 | 77 | 80 | 69 | 83 |
| Birnen | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 15 | 7 | 3 | 8 | 9 | 17 | 14 | 5 | 19 | 11 | 62 | 76 | 85 | 69 | 77 |
| Kirschen | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | 18 | 9 | 12 | 10 | 11 | 18 | 12 | 10 | 28 | 12 | 53 | 76 | 73 | 55 | 72 |
| Pflaumen | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 10 | 8 | 12 | 9 | 20 | 9 | 4 | 21 | 14 | 58 | 80 | 84 | 63 | 74 |
| Mirabellen | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 10 | 6 | 9 | 9 | 18 | 10 | 6 | 20 | 14 | 58 | 79 | 84 | 68 | 74 |
| Aprikosen | 5 | 0 | 3 | 6 | 7 | 25 | 4 | 5 | 3 | 0 | 10 | 12 | 5 | 22 | 12 | 60 | 84 | 87 | 69 | 81 |
| Pfirsiche | 16 | 2 | 4 | 8 | 5 | 22 | 11 | 7 | 8 | 12 | 14 | 13 | 7 | 23 | 16 | 49 | 73 | 82 | 61 | 67 |
| Walnüsse | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 5 | 12 | 9 | 3 | 10 | 12 | 80 | 84 | 87 | 78 | 81 |
| Aus der Meldung des Monats: | Zeitraum | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||
| zufr. | unzur. | zufr. | unzur. | zufr. | unzur. | zufr. | unzur. | zufr. | unzur. | zufr. | unzur. | ||
| Mai | bis 20.05. | 52% | 48% | 49% | 51% | 64% | 36% | 81% | 19% | 70% | 30% | 45% | 55% |
 |
| Durch den Monilia-Pilz abgestorbener Trieb (Blätter und Blütenbüschel). Aufnahme am 17.06.2002 in Hannover. |
Nach diesem Wetterverlauf während der Obstbaumblüte verwundert es nicht, dass die Berichterstatter schon in der Umfrage zum 10. Juni mit einer sehr geringen Kirschenernte rechneten. Nach drei sehr guten Kirschjahren wurden die noch möglichen Erträge der Süßkirschen, mit 448 Hektar Anbaufläche nach den Äpfeln (6612 ha) die zweithäufigste Obstart in den niedersächsischen Marktobstbetrieben, zum Stichtag 10. Juni auf weit weniger als die Hälfte der Vorjahresernte geschätzt. Dann kam es in der 29. Woche (17. und 18. Juli) zu Rekordniederschlagsmengen im Kammergebiet Hannover. Damit war die Kirschenernte vorbei, denn die reifen Spät-Kirschen platzten bei der Feuchtigkeit auf und konnten nicht mehr verkauft werden. Die drei häufigsten Steinobstarten in den niedersächsischen Marktobstbetrieben (Süßkirschen, Pflaumen, Sauerkirschen) werden als nicht lagerfähige Saisonware neben dem Hauptproduktionszweig, dem Apfelanbau, angebaut und liefern zusammen mit den auch häufig zusätzlich angebauten Beerenfrüchten erste Einnahmen im Erntejahr.
Das ungünstige Wetter zur Blüte bewirkte eine relativ lange Blütezeit (vgl. Tab. 1). Feuchtes Wetter und eine lange Blüte bieten den Sporen der Spitzendürre (Monilia) lange Gelegenheiten, über die Blüte die jungen Triebe zu infizieren. An vielen Kirschbäumen, insbesondere Sauerkirschen, hingen dieses Jahr im Juni und Juli statt bald reifender Früchte die wegen dieser Pilzkrankheit abgestorbenen, verdorrten jungen Triebe an den Zweigen.
| Jahr | Süßkirschen | Sauerkirschen | Pflaumen/Zwetschen | ||||||
| Anbaufläche* | Ertrag | Erntemenge | Anbaufläche | Ertrag | Erntemenge | Anbaufläche | Ertrag | Erntemenge | |
| ha | dt/ha | dt | ha | dt/ha | dt | ha | dt/ha | dt | |
| 1997 | 520 | 115,0 | 59 778 | 177 | 39,7 | 7 033 | 170 | 120,8 | 20 539 |
| 1998 | 520 | 98,9 | 51 451 | 177 | 34,7 | 6 149 | 170 | 99,3 | 16 889 |
| 1999 | 520 | 168,1 | 87 425 | 177 | 99,9 | 17 691 | 170 | 163,9 | 27 870 |
| 2000 | 520 | 162,3 | 84 416 | 177 | 129,9 | 22 998 | 170 | 148,8 | 25 288 |
| 2001 | 520 | 145,8 | 75 796 | 177 | 78,2 | 13 848 | 170 | 153,0 | 26 004 |
| 2002 | 448 | 66,8 | 29 958 | 69 | 39,3 | 2 719 | 207 | 97,2 | 20 115 |
* Die Anbauflächen werden nur alle 5 Jahre in der Obstanbauerhebung erfragt. 2002 war wieder eine solche Befragung.
Die guten Vegetationsbedingungen mit Wärme und Feuchtigkeit im Mai und Juni hatten die Obsthölzer vor allem in das Wachstum der Bäume und nicht in die Fruchtbildung gesteckt. Dadurch war der Juni/Julifall relativ hoch. Es fehlte die Sonne. Die Schäden durch das zu lange in den Plantagen stehende Wasser nach den Dauerregenfällen Mitte Juli bis Mitte August an den Bäumen sind hoch. Viele Bäume, insbesondere die empfindlichen Kirschen, müssen ersetzt werden.
| Jahr | Äpfel | Birnen | Erdbeeren | ||||||
| Anbaufläche* | Ertrag | Erntemenge | Anbaufläche | Ertrag | Erntemenge | Anbaufläche | Ertrag | Erntemenge | |
| ha | dt/ha | dt | ha | dt/ha | dt | ha | dt/ha | dt | |
| 1997 | 7851 | 241,7 | 1 897 446 | 274 | 123,1 | 33 700 | 955 | 85,6 | 81 797 |
| 1998 | 7851 | 281,3 | 2 208 453 | 274 | 145,4 | 39 803 | 1098 | 89,6 | 98 386 |
| 1999 | 7851 | 316,6 | 2 485 679 | 274 | 190,0 | 52 035 | 1166 | 102,8 | 119 868 |
| 2000 | 7851 | 345,3 | 2 711 141 | 274 | 345,3 | 59 325 | 1387 | 98,0 | 135 839 |
| 2001 | 7851 | 300,7 | 2 361 123 | 274 | 216,6 | 45 328 | 1562 | 117,8 | 184 011 |
| 2002* | 6612 | 189,2 | 1 250 853 | 243 | 163,4 | 39 646 | 1540 | 103,0 | 158 669 |
* Die Anbauflächen werden nur alle 5 Jahre in der Obstanbauerhebung
erfragt. 2002 war wieder eine solche Befragung.
Seit diesem Jahr werden nur noch die Obsterträge in den Betrieben mit Marktobstanbau erfragt, also die Ernte im "professionellen" Obstanbau. Die Ermittlung des Hobby-Anbaues in den Gärten, für dessen Ermittlung schon lange die Datengrundlage (Obstbaumzählung in den Gärten usw.), die Berichterstatter und das volkswirtschaftliche Interesse fehlte, wurde nun auch offiziell aufgegeben. Es interessiert nur noch der Obstanbau als Wirtschaftszweig und nicht mehr die aus längst vergangenen Zeiten stammende Zielsetzung, die "Obstversorgungsmöglichkeit" der deutschen Bevölkerung zu ermitteln.
Die Gemüseanbauflächen im Land sind breiter verteilt als die Obstflächen, so dass ungünstige Klimaverhältnisse in einem Anbaugbiet im Landesdurchschnitt besser ausgeglichen werden können. Der Gemüseanbau auf dem Freiland wurde dieses Jahr um fast 10% ausgedehnt. Die Kartons der großen Erzeuger und Erzeugergemeinschaften aus Niedersachsen sind in den Verbraucher- und Discountmärkten immer öfter und länger zu sehen. Der Konzentrationsprozeß hin zu großen Anbauern, die die Zentralen der Lebensmittelketten direkt befliefern können, läuft weiter (vgl. Beschreibung des Gemüseanbaues im Land).
Die Erträge der einzelnen Früchte waren stark standortabhängig. In den Senken, Flußniederungen und auf Feldern mit schwereren, nassen Böden kam es nach dem 20. Juli zu Totalausfällen, z.B. wegen Überflutung der Ilmenau, wegen Wasserschäden bzw. Unbefahrbarkeit der Felder. Wenn das Gemüse ca. 2 Tage im Wasser steht, sterben die Wurzeln wegen Sauerstoffmangel ab und die Pflanze verfault. Ein feucht-warmes Treibhausklima fördert das Massenwachstum, aber zugleich auch die Ausbreitung von Pilzinfektionen und damit das vorzeitige Absterben der Pflanzen. Viele Gemüsearten müssen zu einem ganz exakten Wachstumspunkt geerntet werden und wenn dann das Feld nicht befahrbar ist, ist die Ernte verloren. Blühenden Brokkoli oder geschossten Salat kann man nicht verkaufen. Dafür lieferten Standorte mit wenig Beregnungsmöglichkeiten auf trockenen Böden dieses Jahr ungewohnt gute Erträge. Die Berechnung der Erntemengen war schwierig, da die Erntemeldungen dieses Jahr extrem weit streuten. Von sehr guten Erträgen bis zu den Totalausfällen waren alle Zwischenstufen vertreten. Wenn nicht die großen Nässeschäden gewesen wären, hätte das feucht-warme Wetter ein gute Ernte gebracht. So haben nur die Anbauer auf sehr leichten Böden von dem Wetter profitiert, alle anderen mussten Ertragsausfälle einstecken.
 |
| Spargelbauer bei Peine am 23. Juni 2002 |
Die Spargelpflanzen konnten im Sommer 2001 genügend Reservestoffe in den Wurzeln einlagern und so ein gutes Fundament für den diesjährigen Austrieb legen. Die Spargelsaison 2002 fing nach einer Wärmeperiode mit geringen Mengen unter Folie schon sehr früh im April an. Bis ca. 10. Mai war es dann allerdings zu kalt für hohe Erträge (vgl. Link Wettergrafiken, Grafik 5). Die tägliche Ernte erreichte ab 10. Mai ein normales Niveau und hielt sich während der Saison relativ konstant, lag aber insgesamt noch 18% unter den Mengen des wechselhaften Vorjahres. Dabei gab es weder eine längere Hitzeperiode mit plötzlich zu hohen Erträgen noch eine längere Kälteperiode mit Ertragsausfällen.
Der Anteil der begehrten, dicken, gewichtigen Stangen enttäuschte sehr und gibt einige Rätsel auf. Manche Meinungen gehen dahin, dass das mit dem extrem nassen September 2001 (vgl. Wettergrafiken) im Zusammenhang stehen könnte. Manchmal regnete es auch während der Saison bei den häufigen Unwetter so stark, dass selbst auf den Sandböden zwischen den Reihen das Wasser stand. Der Spargelabsatz litt anscheinend unter der gerade zur Saison heftigen Euro-Teuro Diskussion. Die Preise lagen trotz geringerer Ernte unter denen des Vorjahreszeitraumes! Entgegen allen Erwartungen griffen die Verbraucher trotzdem zögerlicher zu dem Edelgemüse, was sich in den Erzeugererlösen doppelt (Menge + Preis) bemerkbar machte.
 |
| Erdbeerenfeld bei Hannover am 11. Juni 2002 |
Die Erdbeerensaison verlief dieses Jahr für viele Betriebe sehr unglücklich. Es fing schon damit an, dass es zur Blüte der unter Folie verfrühten Sorten relativ kalt und windig war. Trotz Folienabdeckung über Nacht kam es, wie beim Obst zu Frostschäden an den Blüten. Zugleich hinderten klamme Temperaturen und kräftige Winde die Bienen tagsüber am emsigen Bestäubungflug. Vom Frost teilgeschädigten Blüten entwickeln verkrüppelte Fruchtformen.
Der Ertrag und die Fruchtgröße auf den ab ca. 18. Mai geernteten, verfrühten Feldern war unbefriedigend, bei allerdings guten Preisen. Das anschließend feucht-warme Wetter im Juni förderte das Mengenwachstum, brachte aber ganz erhebliche Probleme mit schnell sich ausbreitenden Pilzkrankheiten. Zusätzlich verhagelten dieses Jahr die ungewöhnlich häufigen Unwetter manche Ertragshoffnung.
Die Hauptsaison setzte wieder relativ früh (Ende Mai - Anfang Juni) ein und dauerte bei den Spätsorten bis in die zweite Juliwoche. Bis weit in den August hinein wird noch die speziell spät gepflanzte, aufwändige "Terminware" geerntet. Zur Hauptsaison fehlte die Sonne und es war zu feucht. Die wenigen Sonnentage zwischendurch führten zu einer plötzlichen Reife großer Mengen, was oft weder von der Pflücke noch vom Verkauf bewältigt werden konnte und die Preise stürzten. Die insgesamt geernteten Mengen, dieses Jahr schon eher als "Durchschnitt von Ernteglück und Erntepech" zu bezeichnen, schwankten innerhalb der Saison, von Gebiet zu Gebiet und von Betrieb zu Betrieb sehr stark, so dass die Zahl in der Ergebnistabelle wirklich nur den -guten- rechnerischen Durchschnitt beschreibt. Es gab durchweg sehr oft Qualitätsprobleme, so dass mit sehr hohem Sortieraufwand, hohen Kosten, hohen Verlusten geerntet werden musste.
Die Hochzeiten der Selbstpflückwelle scheinen vorbei zu sein. In den Selbstpflückplantagen ist bei wenigen Regentropfen der Besuch sehr gering. Trotzdem muss immer durchgepflückt und gesäubert werden, denn nur gepflegte, konsequent geführte Anlagen sind Besuchermagneten. Es ist auch bei den Erdbeerplantagen der Trend zu größeren Flächen mit einer straff organisierten Vermarktung zu bemerken, die von meist polnischen Saisonkräften abgeerntet werden. Auch der Export entwickelt sich, hat aber mit den gleichen Problemen wie der Import, z.B. aus Italien und Spanien, zu kämpfen: Die Erdbeere schmeckt ausgereift gepflückt und innerhalb weniger Stunden gegessen am besten. Der große Vorteil der lokalen Erzeuger. Die reife Frucht muss extrem schnell vermarktet werden. Lange Transportzeiten schaden dem Geschmack und fördern den Gammelanteil an den unruhigen Beeren. Auch mit Kühltransportern oder einer "Nachreife" unreif gepflückter Beeren während des Transportes und der Lagerung ist dies prinzipiell nicht zu beheben. Rote Früchte ohne Geschmack fördern den Absatz in keinem Land. Nur die gesunden Leckereien werben und bringen neue Kunden.
Die zwei nachfolgenden Bilder zeigen ein Erdbeeren- und ein Maisfeld bei Hameln, auf denen nach einem Hagel an eine Ernte nicht mehr zu denken war.
 |
| Zerstörtes Erdbeerenfeld bei Hameln nach einem Hagelschauer am 10.07.2002 |
 |
| Zerstörtes Maisfeld bei Selxen (Kreis Hameln) nach extremen Hagel am 10. Juli 2002 |
Die Ernteschätzer des statistischen Landesamtes bekommen nach jeder Umfrage die Ergebnisse in einem Infoschreiben mitgeteilt. Die Infoschreiben enthalten den aktuellen Stand der Schätzungen zu den jeweiligen Erhebungsstichtagen. Die pdf-Dateien werden in einem neuen Browserfensters geöffnet, wenn Sie den Arcobat-Reader installiert haben. Mit dem "X" -Knopf (Schließen) kommen Sie dann wieder auf diese Seite zurück.
Wenn Sie die Links in der Vorspalte öffnen, werden Ihnen die z.T. als pdf-Dateien abgespeicherten Ergebnistabellen in sich separat öffnenden Browserfenstern angezeigt.
Hannover, am 28. März 2003, Georg Keckl
Niedersächsisches Landesamt für Statistik (NLS),
Dezernat 34, Georg Keckl, Tel.: 0511 9898 3441, Fax 4344
Weitere Ergebnisse aus der Erntestatistik finden Sie unter:
http://www.nls.niedersachsen.de/Tabellen/Landwirtschaft/Landwirtschaft.html
E_mail: georg.keckl@nls.niedersachsen.de
Georg Keckl