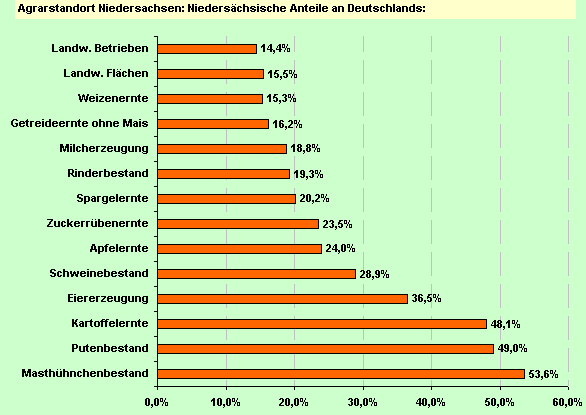
(Die Ermittlung der amtlichen Hektarerträge für Feldfrüchte in Niedersachsen)
Am 8.11.1877 beschloss der damalige Bundesrat, ab dem Erntejahr 1878 in allen Ländern des Deutschen Reiches eine einheitliche "Ermittlung der landwirtschaftlichen Bodennutzung und der Ernteerträge" durchführen zu lassen. Einige Verfahren aus dieser Zeit haben sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Anlass genug, einmal etwas breiter über die Erntestatistik im Bundesland mit der größten Getreide-, Zuckerrüben- und Kartoffelernte zu berichten.
Ein Bundesland ist groß, hat viele Bauern und noch mehr Felder. Wie soll man da einen Ertrag für ein ganzes Land bestimmen? Was legitimiert staatliche Stellen die Erträge zu messen? Warum hat der Staat überhaupt ein Interesse an den Erträgen der Feldfrüchte und für was werden die Ergebnisse gebraucht? Wie funktioniert die Ernteermittlung? Ist die Ernteermittlung nach heutigem Muster noch auf der Höhe der Zeit? Wie wird die Zukunft der Erntestatistik, z. B. unter den Bedingungen des "Precision Farming", sein? Auf diese Fragen soll hier eingegangen werden.
"Woher wisst ihr, wie viel geerntet wurde?", werden die Mitarbeiter der Erntestatistik immer wieder gefragt, besonders von skeptischen Landwirten wenn ihre Felder zur Ertragsmessung herangezogen werden sollen. Da niemand in der Lage ist, jede geerntete Fuhre über eine Waage zu ziehen und so das tatsächliche Gewicht der niedersächsischen Ernte zu ermitteln, berechnen wir die Ernte über Stichproben, Umfragen und Hochrechnungen. Aber Ernteschätzungen gibt es nicht nur von der amtlichen Erntestatistik. Doch die Zuverlässigkeit der Zahlen ergibt sich aus dem Erhebungsweg. Die Erhebungsprinzipien der amtlichen Statistik sind seriös, nicht billig, kein Geschäftsgeheimnis und können deshalb hier gezeigt werden.
Die amtliche Statistik wird, wie alle Staatsstellen, nur auf der Grundlage von Gesetzen tätig. Die Durchführung der Agrarstatistiken ist angeordnet im:
Zur praktischen Durchführung wurden Richtlinien und Arbeitsanweisungen unter Einbeziehung von Sachverständigen aus den Ministerien, Kammern, Instituten und Verbänden erarbeitet, z. B. in der "Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen BEE". Technische und methodische Fragen werden jeweils im Mai eines Jahres auf der sogenannten "Merkbuchtagung" des "Arbeitskreises Verfahrensfragen der Bodennutzungs- und Erntestatistik" zwischen den zuständigen Ministerienvertretern und Vertretern der Statistikämter der Länder und des Bundes erörtert und geregelt.
Nun muss das Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage noch nicht allein besagen, dass diese Tätigkeit auch sinnvoll ist. Über den Sinn der Erntestatistik gibt es allgemeine, seit 125 Jahren voneinander abgeschriebene Erklärungen.
Etwas freier, aus der Lebenserfahrung heraus formuliert, könnte man sagen:
Wer irgendetwas über die Entwicklung, die Stellung und den Zustand der Landwirtschaft in einem Land sagen will, muss auch auf langjährig objektiv ermittelte Produktionszahlen zurückgreifen können. Die Hektarerträge, die Anbauflächen, die Erntemengen und die Produktionsleistung in Euro sind international vergleichbare Kennziffern. Die Berechnung der Wertschöpfung in der Landwirtschaft im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftsstatistiken (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung) muss auf vertrauenswürdigen Vorgaben aller Produktions- und Preisstatistiken aufbauen.
Auch wenn ein Einzelbetrieb wissen will, ob seine Ernte gegenüber anderen Erzeugern gut oder schlecht ausgefallen ist, muss er objektive Vergleichszahlen kennen und keine Erträge vom Hörensagen. Wer sich über Betriebe, Gebietseinheiten, Wirtschaftszweige, Länder oder gar Zusammenschlüsse von Volkswirtschaften informieren will, wer sie beschreiben, vergleichen oder lenken will, muss verlässliche, vergleichbare Zahlen jedes Teilbereiches haben. Die Erntestatistiken werden, wie alle Statistiken in den entwickelten Ländern, nach sehr ähnlichen, von jedem Land einsehbaren, abgestimmten und gegenseitig beobachteten Prinzipien durchgeführt. Damit sind Länder- und Zeitvergleiche möglich und sinnvoll.
Zahlen aus der Statistik gibt es viele, Leute die sie einschätzen und in die aktuellen Diskussionen einbringen können, wenige. Das ist nämlich sehr mühsam. Hier sind ein paar Kennziffern der niedersächsichen Landwirtschaft, die das eben Geschriebene etwas greifbarer untermalen sollen:
| Jahr 1999 | Einheit | Land | Bezirke | |||
| Niedersachsen | Braunschweig | Hannover | Lüneburg | Weser-Ems | ||
| Arbeitsplätze* in der Ldw. | AK-Einheiten | 88 797 | 10 107 | 15 391 | 25 749 | 37 550 |
| Anzahl | 65 650 | 7 425 | 11 367 | 17 841 | 29 017 | |
| Darunter Hauptwerbsbetr. | Anzahl | 34 358 | 3 430 | 5 694 | 9 623 | 15 611 |
| Bruttowertschöpfung** Landw./Forst/Fischerei |
Mio.Euro 1996 |
4 425 | 418 | 693 | 1 102 | 2 212 |
| Bruttowertschöpfung Anteil Landw. an Gesamt |
% 1996 |
2,9% | 1,3% | 1,5% | 4,3% | 4,6% |
| D. Kaufpreis Ackerland 2000 | Euro je ha | 17 846 | 16 949 | 21 822 | 10 407 | 20 066 |
| D. Kaufpreis Grünland 2000 | Euro je ha | 9 357 | 7 314 | 8 613 | 7 898 | 10 698 |
| D. Pachtpreis Ackerland 1999 | Eu. je ha*** | 293 | 269 | 311 | 215 | 370 |
| D. Pachtpreis Grünland 1999 | Eu. je ha*** | 189 | 130 | 166 | 154 | 234 |
| Anteil Pachtland an LF*** | % 1999 | 42% | 46% | 43% | 42% | 39% |
| Großvieheinheiten****(GV) | GV | 3 120 266 | 136 963 | 369 105 | 843 477 | 1 770 721 |
| Viehdichte | GV/ha LF | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,9 |
| Rinderbestand | GV | 1 924 256 | 87 279 | 194 700 | 640 064 | 1 002 212 |
| Schweine | GV | 887 967 | 35 624 | 134 792 | 152 649 | 564 903 |
| Geflügel | GV | 206 443 | 1 944 | 20 932 | 14 692 | 168 874 |
| LF aller Landw. Betriebe | ha | 2 661 379 | 388 777 | 501 446 | 821 863 | 949 293 |
| Grünlandanteil an LF | % | 31,9% | 13,1% | 16,9% | 39,3% | 41,0% |
| durchs. EMZ***** der LF | EMZ in 1000 | 42,5 | 55,61 | 49,83 | 37,17 | 37,86 |
| Ackerland (AF) 1999 | ha | 1 792 569 | 336 871 | 414 841 | 486 180 | 554 677 |
| Zuckerrübenanteil an AF | % | 6,9% | 16,2% | 10,1% | 5,5% | 0,3% |
| Kartoffelanteil an AF | % | 7,4% | 3,4% | 4,5% | 10,6% | 9,2% |
| Getreideanteil an AF | % | 50,9% | 61,5% | 58,1% | 47,6% | 41,9% |
| Maisanteil an der AF | % | 17,4% | 2,3% | 7,7% | 16,4% | 34,8% |
* AK Einheiten = Zusammenfassung von Teil- und Vollzeitbeschäftigten zu Vollzeitarbeitsplätzen
** Bruttowertschöpfung = Wert der aller erzeugten Produkte und Dienstleistungen abzüglich der Vorleistungen
*** Ohne Pachtungen von Familienangehörigen
**** GV = Großvieheinheiten, Zusammenfassung von Nutztieren nach Gewicht (z. B. 1 Rind mit 2 Jahren= 1 GV, 1 Schwein mit 50kg= 0,16 GV, 1 Legehenne= 0,004 GV)
**** EMZ = "Ertragsmeßzahlen" Maß für die Bodenqualität (Bodenpunkte), bester Boden= 100 EMZ, schlecheste Böden ca. 20 EMZ, LF= Landwirtschaftlich genutzte Fläche
Die niedersächsische Landwirtschaft ist modern und hoch produktiv. Sie hat innerhalb der westdeutschen Länder den höchsten Anteil an der Bruttowertschöpfung eines Landes und verglichen mit der Anzahl der Betriebe und der Flächenausstattung überproportionale Anteile an:
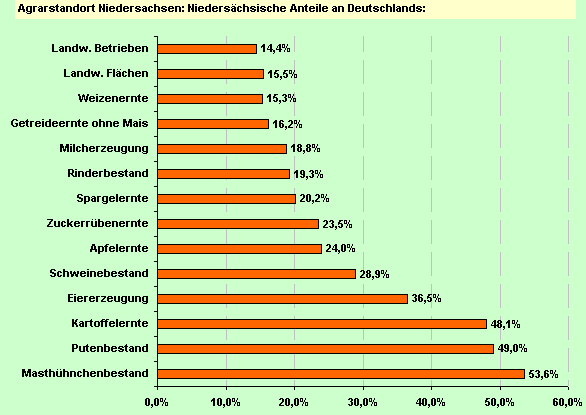 |
| Die alten Rübenstandorte in der Börde, die schlagkräftigen Kartoffelerzeuger in der Heide, die boomende Veredelungsbranche und die agilen Gartenbaubetriebe in Weser-Ems machen die niedersächsiche Landwirtschaft zusammen mit der gesunden Ernährungsindustrie sehr stark. |
Die deutsche Erntemenge wird zur Zeit mit Hilfe von drei Erhebungen berechnet:
Die Hauptforderungen an die Erntestatistik sind, dass die Ernteergebnisse möglichst zeitnah zur oder kurz nach der Ernte gesichert vorliegen sollen. Deshalb startet die Ermittlung der Anbauflächen ("Bodennutzungshaupterhebung") schon nach der Frühjahrsaussaat und stellt die Anbauflächen der Erntestatistik (BEE und EBE) rechtzeitig vor der Haupterntezeit zur Verfügung. Schon die Veränderungen des Anbauumfanges einzelner Früchte gibt erste Hinweise auf die zu erwartenden Erntemengen. Die Erntemenge des Landes wird dann durch Multiplikation der von den Erzeugern erfagten Anbauflächen mit den über die Ernteberichterstattung (EBE) und die Besondere Ernteermittlung (BEE) ermittelten Hektarerträgen errechnet.
Die Anbauflächen werden völlig getrennt von den Hektarerträgen ermittelt. Von jedem entwickelten Land sind die Anbauflächen und die Hektarerträge bekannt. Müsste zugleich zur Ertragsfeststellung eine Ermittlung des Anbauumfanges erfolgen, würden die Ergebnisse sehr spät vorliegen (vgl. 5.1 "Nutzung von Buchführungsergebnissen"). Die "Bodennutzungshaupterhebung" (BO) wird alle vier Jahre total, d. h. alle Landwirte werden nach ihrem Anbau gefragt, und in den Zwischenjahren als geschichtete Stichprobe (ca. 20% der Betriebe) durchgeführt. Sie macht im Rahmen der Ernteermittlung die meiste Arbeit. Es besteht eine gesetzliche Auskunftspflicht über den Anbau auf den Feldern.
Das deutsche System der Ermittlung der durchschnittlichen Hektarerträge ist heute eine wissenschaftlich fundierte Kombination aus einem Stichproben- und einem Befragungsverfahren. Das Stichprobenverfahren nennt sich "Besondere Ernteermittlung" (BEE) und wird im nächsten Kapitel erklärt. Das Befragungsverfahren ist die "Ernte- und Betriebsberichterstattung" (EBE). Die EBE liefert Hektarerträge und Ertragsprognosen für Obst, Gemüse, Feldfrüchte und Grünland. Es beruht auf den Ertragsschätzungen ehrenamtlich meldender Landwirte, "Ernteberichterstatter" genannt, für ihre Ortschaften und Betriebe. Nur die EBE kann für Ertragsvorschätzungen genutzt werden. Sie stützt sich dazu auf die Erfahrung der Ernteberichterstatter. Zuverlässige Ertragsprognosen geben allen Beteiligten mehr kurzfristige Planungssicherheit. Da die Marktpreise durch das weltweite Angebot und Nachfrage bestimmt sind, würden Risikoaufschläge durch Planungsunsicherheiten der Handelsstufen vor allem auf Kosten der schwächsten Glieder der Erzeugungskette, den Landwirten, gehen.
Bei Obst und Gemüse ist die Anzahl der meldenden Landwirte so ausgelegt, dass nur ein durchschnittlicher Ertrag für das Land ausgewiesen werden kann. Bei Feldfrüchten und Grünland sollen Erträge bis auf die Kreisebene ausgewiesen werden, da auch ein regionales Interesse an den Zahlen besteht. Bei der Ermittlung des landesweiten durchschnittlichen Hektarertrages ergänzt das ältere Verfahren der EBE die modernere BEE dort, wo die BEE zu teuer würde. Die aufwändige BEE ist so ausgelegt, dass sie nur den Landesdurchschnittsertrag für die häufigsten Getreidearten (in Niedersachen: Winterweizen, Roggen, Wintergerste, Sommergerste und Triticale) und Kartoffeln (Speise- und Industriekartoffeln) liefern kann. Die Daten der EBE werden bei den Früchten, die auch von der BEE beprobt werden, nur zur Ausweisung der Kammer- und Kreiserträge benötigt. Müssten mit der BEE mehr Früchte beprobt oder gar noch Kammer- und Kreisergebnisse ermittelt werden, so müsste die Anzahl der Probeschnitte so stark erhöht werden, dass damit der vorgegebene Kostenrahmen von ca. 166000 Euro explosionsartig aufgebläht würde.
Die EBE für Feldfrüchte und Grünland wird in Niedersachsen noch nach dem ursprünglichen Verfahren durchgeführt, darum soll dieser Bereich zuerst skizziert werden. Über die Veränderungen im Bereich der Obst- und Gemüse-EBE wird unter den Punkten 3.6 "Obst- und Gemüseernte" und 5.2 "Direkte Befragung der Landwirte" informiert.
Zur Durchführung der Ernteberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland ist das Land in ein flächendeckendes Netz von 1800 Berichtsbezirken aufgeteilt. Jedem Berichtsbezirk, der eine Größe von ca. 500 - 3000 ha haben kann, ist ein Berichterstatter zugeordnet. Dieser schätzt für seinen Bezirk die seiner Meinung nach möglichen Durchschnittserträge der ihm bekannten Früchte. Die Schätzungen gelangen per Postkarte, Brief, Fax und zukünftig auch per E-Mail an das Landesamt für Statistik in Hannover. Hier werden die Einzelmeldungen grob auf ihre Plausibilität geprüft und unter Beachtung der Flächenproportionalität (große Anbauflächen in einem Bezirk geben der Schätzung ein höheres Gewicht) zu einem Landesergebnis zusammengefasst.
Bei der Einteilung der Bezirke wird darauf geachtet, dass diese möglichst ähnliche Bodenverhältnisse aufweisen. Die Einteilung der Bezirke erfolgt nach Gemarkungskarten, bodenkundlichen Standortkarten, durchschnittlichen Ertragsmesszahlen und den Ortsteilergebnissen der Bodennutzungshaupterhebung. Aus der Verschiedenartigkeit der Berichtsbezirke ergeben sich unterschiedliche Berichtsbezirksgrößen. Ein Bezirk mit nur Grünland in einem großen Moorgebiet kann sehr groß sein. Auf wechselhaften Böden, vielgestaltigem Anbau und kleinen Ortsteilsfluren ergeben sich kleinere Berichtsbezirke. Ein Berichtsbezirk darf nicht zu klein werden, darum müssen irgendwo immer Kompromisse gefunden werden. Die Schätzung eines Berichterstatters wird mit den Anbauflächen in seinem Berichtsbezirk gewichtet. Fehlt einmal eine Meldung aus einem Berichtsbezirk, wird diese durch den Durchschnitt ähnlich gelagerter Berichtsbezirke ersetzt. Für ein Ergebnis müssen für alle Berichtsbezirke Ergebnisse vorliegen oder angenommen worden sein. Über die Aufsummierung aller Berichtsbezirke im Land wird ein Landesergebnis errechnet.
Leider hat ein Leinehochwasser in Hannover kurz nach dem Krieg, die Deiche und Wehre hatten Bombenschäden, die Berichtsbezirksakten ab 1877 zerstört. Sonst könnten wir für viele Gemeinden die Liste der Berichterstatter 125 Jahre zurück verfolgen. Oft liegt die Berichterstattung noch immer in der Familie, die das schon 1877 gemacht hatte. Die Ertragseinschätzungen für eine Flur erforderten und erfordern ein hohes Maß an lokaler Erfahrung im Landbau. Die Schätzer müssen deshalb Landwirte mit Ortskenntnissen sein. Das Statistische Landesamt bemüht sich, solche Landwirte als Ernteschätzer zu werben. Sie geben in den Sommermonaten jeweils zum Monatsende ihre Einschätzung über den Wachstumsstand und die Ertragsaussichten/Erträge ab. Die Tabelle unter dem Punkt 3.4 "Monatsmeldungen" ist Bildern aller Monatsmeldungen verlinkt. Beim Ausscheiden von Berichterstattern werden für die frei werdenden Berichtsbezirke laufend neue Berichterstatter gesucht.
Hier ist eine Liste der zur Zeit unbesetzten Berichtsbezirke, für die ich Berichterstatter suche.
Wenn Sie die Ertragshöhe in einem dieser Berichtsbezirke auf Grund ihrer lokalen Erfahrungen ca. einschätzen können, können Sie Ernteschätzer werden. Als Berichterstatter werden sie monatlich über den auch aus Ihren Informationen ermittelten Stand der Ernteeinschätzungen und Ertragsmessungen informiert. Die niedersächsische Erntestatistik liefert ihren Ernteschätzern sehr schnell und sehr detailiert Landes- und evtl. Kreisergebnisse zurück. Ohne diese gegenseitige Information wären heute erfahrungsgemäß nur noch schwer junge Landwirte für eine solche Aufgabe zu finden.
Möchten Sie für einen der unbesetzten Bezirke Ernteberichterstatter werden?
Kurz vor dem Rücksendetermin werden die Berichtskarten oder Faxbögen an die Berichterstatter per Post geschickt. Der Begriff "Karte" wird traditionell noch gern verwandt, da früher viele Rückmeldungen vorfrankierte Postkarten waren. Nur noch die Dezember- und Septemberkarten für die Berichterstatter ohne Fax sind heute noch Postkarten. Im Schnitt 15 Tage nach dem Rücksendetermin wird aus den eingegangenen Rückmeldungen das Ergebnis errechnet und veröffentlicht. Jede Einzelschätzung bleibt natürlich geheim. Die Ergebnisse werden manchmal bis auf die Kreisebene veröffentlicht. Sie dienen der Rückmeldung an die Berichterstatter und der fundierteren Beschreibung der aktuellen Situation. Angeordnet wäre nur eine Meldung der Landeszahlen an Ministerien und das Statistische Bundesamt. Zu Zeiten der Tischrechenmaschinen war mehr auch nicht leistbar. Kreisergebnisse wurden damals in breiten Auffülltabellen mit Rechenanweisungen nur zum Jahresschluss errechnet. Der PC-Einsatz ab 1992 wurde in Niedersachsen zu besseren Auswertungen und zur Personalreduzierung genutzt. Das Stat. Bundesamt veröffentlicht die Ergebnisse bundesweit in den Monatsheften der Fachserie 3, "Land- und Forstwirtschaft, Wachstum und Ernte".
In der folgenden Tabelle sind pdf-Bilder der Monatsmeldungen per Links eingebaut. Berichterstatter können den aktuellen Monat im Internet auch online (siehe Artikel "Erntestatistik online") ausfüllen und abschicken. Falls ein Berichterstatter mir einen solchen Bogen als Meldung online schicken oder den Ausdruck faxen will, muß darauf zumindest seine Berichtsbezirksnummer vermerkt sein, sonst kann der Bogen keinem Gebiet und keiner Kontonummer zugeordnet werden.
| Monatskarte | Rücksendetermin | Inhalt |
| Im April | 15. April | Wachstumsstandsnoten der Felder. Entwicklung der Anbauflächen. |
| Im Juni | 30. Juni | Wachstumsstandsnoten der Hackfrüchte. Vorschätzung des Getreides. Erster Grünlandschnitt. Umfrage nach Lagerbeständen und der Milchverwendung. |
| Im Juli | 31. Juli | Wachstumsstandsnoten der Hackfrüchte. Vorschätzung des Getreides. |
| Im August | 31. August | Wachstumsstandsnoten der Rüben und des Grünlandes. Vorschätzung der Kartoffeln. Schätzung der Getreideernte. |
| Im September | 30. September | Vorschätzung der Hackfruchternte. |
| Im Oktober | 31. Oktober | Schätzung der Kartoffel- und Grünlandernte. |
| Im November | 30. November | Schätzung der Rübenernte. Wachstumsstandsnoten der Herbstsaaten. Prognose der Herbstaussaatflächen. |
| Im Dezember | 31. Dezember | Umfrage nach Lagerbeständen und der Milchverwendung. |
Jede Monatsmeldung enthält noch eine Frage zum Wetter, die aus dem Gefühl heraus beantwortet werden kann (zu naß, zu trocken, normal). Außerdem können auf jeder Karte noch handschriftliche Vermerke gemacht werden, wenn es in dem Bezirk ungewöhnliche, ertragsbeeinflussende Vorkommnisse gab (Überschwemmung, Hagel, etc), so dass wir diese abweichenden Einschätzungen verstehen können.
Wir sind von Hannover aus nicht in der Lage, einzelne Einschätzungen zu beurteilen. Eine Einschätzung fällt nur dann auf, wenn sie stark von ähnlichen Bezirken abweicht. Hier hat der Einsatz der PC`s Verbesserungen gebracht, da Abweichungen schneller auffallen und schnell eine Rückfrage gemacht werden kann. Durch das statistische Gesetz der "Großen Zahl" gleichen sich die Abweichungen nach oben und unten bei einer ausreichend großen Anzahl von Meldungen bald aus und pendeln sich um den tatsächlichen Mittelwert ein.
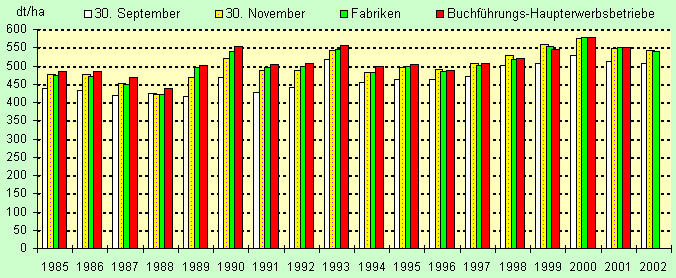 |
| Einschätzung der Zuckerrübenerträge durch die Berichterstatter zum 30.09. und 30.11., Endmeldungen der Fabriken und Buchführungsergebnisse der Haupterwerbsbetriebe für Niedersachsen |
Einzelmeldungen können also nicht geprüft werden, aber was man machen kann, ist z. B. das Ergebnis der Einschätzungen der Berichterstatter über die Zuckerrübenerträge mit dem Ergebnis der Zuckerfabriken vergleichen. Alle Zuckerrüben werden gewogen und die Fabriken erfragen die Anbauflächen. Diese Kontrollmöglichkeit ergibt regelmäßig, dass die Berichterstatter mit ihren Schätzungen zum 30.11. immer erstaunlich genau die zwei Monate später vorliegenden, regionalisierten Endergebnisse der Zuckerfabriken treffen, siehe Grafik. Die Ergebnisse der Buchführungsbetriebe (Haupterwerbsbetriebe im BML- Testbetriebsnetz der Kammern für Niedersachsen) sind nur zu Vergleichszwecken hier mit aufgeführt.
Die Qualität der Vorschätzungen für Getreide und Kartoffeln lässt sich natürlich sehr leicht an den endgültigen Ergebnissen der BEE ("Besondere Ernteermittlung", siehe Punkt 4) messen. Die Qualität ist regelmäßig gut, hohe oder niedrige Ernten werden meist früh als solche erkannt. Extremen, unerwarteten Abweichungen können aber erst mit dem Näherrücken der Erntetermine besser abgeschätzt werden. Bei extremen Wetterperioden wie 1994 (vor dem 21. Juni sehr nass, dann extreme Hitze) sinken die Einschätzungen, die sich aber dann im letzten Moment wegen eines ausgiebigen Regentages in der Hitzeperiode oder plötzlich guten Erntewetters doch noch umwandeln können. Hohe Ernteverluste durch einen nasskalten Sommer und einen verregneten August (wie 1998) können natürlich Ende Juni und Ende Juli noch nicht vorhergesehen werden. Die Berichterstatter haben deshalb gerne die Tendenz, je früher desto vorsichtiger zu schätzen, insbesondere wenn sie im Vorjahr von der Ernte enttäuscht wurden. Bisher wurde aber noch nichts Besseres zur breiten Ertragsprognose gefunden als diese Erfahrungswerte der örtlichen Landwirte.
Bei der Kommentierung von Ernteprognosen sind immer auch regionale Unterschiede zu beachten, denn eine gute Ernte in den sandigen Frühdruschgebieten oder der Börde bedeutet noch keineswegs eine gute Ernte im Spätdruschgebiet der Seemarschen oder umgekehrt. Auch Landwirte sind von diesen Unterschieden manchmal überrascht.
Als Erfahrungswert kann man sagen, dass in einem trockenen Jahr geringe Getreideerträge aus der Heide und der Geest, extrem gute Erträge aus der Marsch und sehr gute Erträge aus der Börde zu erwarten sind. Dünnere Bestände werden gerne unterschätzt. In nassen Jahren wird in der Heide und auf der Geest überdurchschnittlich gut gedroschen, während die Marschen schnell "absaufen" und die Bördeböden immer noch sehr gute Erträge liefern, wenn rechtzeitig gedroschen werden kann. Dichte Bestände in nassen Jahren werden manchmal überschätzt, da die Schäden durch Pilzinfektionen oft sehr verdeckt sind. Sommergetreidearten reagieren heftiger auf Trockenjahre als Wintergetreidearten.
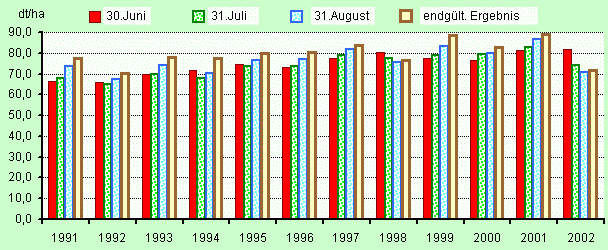 |
| Prognosen (Erntevorschätzungen zu den Meldeterminen) und endgültiger Winterweizenertrag |
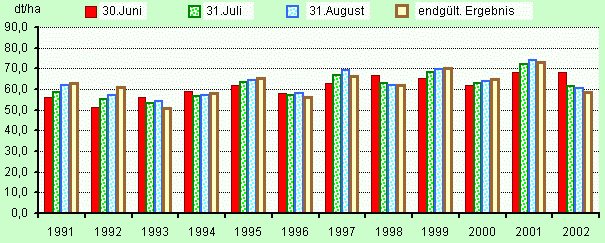 |
| Prognosen (Erntevorschätzungen zu den Meldeterminen) und endgültiger Wintergerstenertrag |
<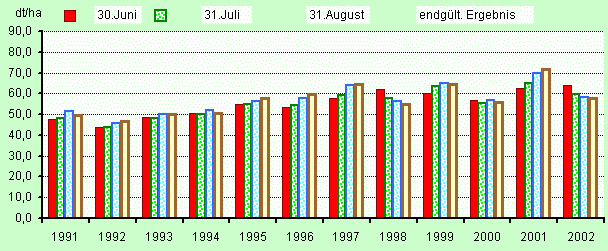 |
| Prognosen (Erntevorschätzungen zu den Meldeterminen) und endgültiger Roggenertrag |
Ebenso lassen sich Ländervergleiche EBE/BEE anstellen. In der folgenden Tabelle sind die unterschiedlichen EBE- und BEE- Ergebnisse für Winterweizen und ihre Abweichungen nach Bundesländern aufgeführt. Winterweizen wird von den Berichterstattern im Durchschnitt zu vorsichtig eingeschätzt. Den schnellen Ertragszuwachs der letzten Jahre haben die Berichterstatter immer mit etwas Verzögerung in ihre Meldungen eingebracht. Die Zahlen sind dem jährlich erscheinenden Abschlussbericht des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft über die Besondere Ernteermittlung bei Getreide und Kartoffeln in Deutschland entnommen .
| Land | Endgültige Ernteschätzung der EBE | Endgültige Messungen der BEE | Abweichungen BEE / EBE | |||||||||
| Winterweizen-Ertrag in dt/ha | Winterweizen-Ertrag in dt/ha | Ertragsabweichungen in % | ||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Baden-Württemberg | 62,7 | 64,1 | 61,6 | 64,1 | 66,7 | 72,7 | 63,4 | 69,6 | +6,4 | +13,3 | +2,8 | +8,6 |
| Bayern | 66,1 | 67,0 | 63,6 | 67,4 | 66,0 | 69,4 | 64,4 | 69,6 | -0,2 | +3,5 | +1,3 | +3,3 |
| Brandenburg | 51,5 | 58,5 | 62,4 | 49,4 | 53,5 | 61,3 | 66,2 | 53,1 | +3,9 | +4,9 | +6,1 | +7,4 |
| Hessen | 72,0 | 70,6 | 75,5 | 72,7 | 72,9 | 73,1 | 77,3 | 71,9 | +1,3 | +3,6 | +2,4 | -1,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 70,9 | 73,4 | 75,9 | 67,4 | 74,3 | 74,7 | 77,3 | 69,0 | +4,7 | +1,7 | +1,8 | +2,3 |
| Niedersachsen | 81,6 | 75,4 | 83,4 | 79,8 | 83,8 | 76,7 | 88,4 | 82,6 | +2,7 | +1,7 | +6,0 | +3,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 79,3 | 70,5 | 79,9 | 78,4 | 86,5 | 74,1 | 87,3 | 81,1 | +9,1 | +5,1 | +9,3 | +3,4 |
| Rheinland-Pfalz | 63,0 | 62,9 | 63,4 | 63,8 | 67,6 | 69,5 | 68,1 | 66,8 | +7,2 | +10,5 | +7,4 | +4,7 |
| Saarland | 61,9 | 63,2 | 58,6 | 59,9 | 67,3 | 66,8 | 63,5 | 65,2 | +8,8 | +5,7 | +8,4 | +8,8 |
| Sachsen | 63,4 | 65,3 | 68,0 | 62,9 | 66,2 | 66,4 | 70,6 | 64,7 | +4,4 | +1,7 | +3,8 | +2,9 |
| Sachsen-Anhalt | 65,1 | 64,8 | 73,7 | 64,9 | 70,4 | 72,2 | 81,7 | 71,5 | +8,1 | +11,4 | +10,9 | +10,1 |
| Schleswig-Holstein | 89,2 | 83,1 | 90,5 | 91,3 | 90,7 | 82,8 | 92,0 | 96,5 | +1,6 | -0,3 | +1,6 | +5,7 |
| Thüringen | 62,3 | 63,1 | 68,6 | 67,7 | 67,8 | 68,4 | 73,5 | 69,2 | +8,8 | +8,4 | +7,1 | +2,2 |
| Deutschland | 70,3 | 69,0 | 72,8 | 70,1 | 73,4 | 72,4 | 76,4 | 73,2 | +4,4 | +4,9 | +5,0 | +4,4 |
Die BEE liefert für ihre Früchte jeweils das Landesergebnis. Das EBE- Ergebnis wird mit einem Korrekturfaktor an das BEE- Ergebnis angeglichen, so dass die aus den EBE- Meldungen errechneten Kreis- und Kammerergebnisse in der Summe auch den ausgewiesenen BEE- Wert ergeben. Die Ergebnisse der Erntestatistik können auch mit den Ergebnissen der Landessortenversuche und mit Buchführungsergebnissen verglichen werden, vgl. Punkt 5.1 "Nutzung von Buchführungsergebnissen".
Auch die Ernteberichterstattung über Gemüse- und Obst verfügte ursprünglich über ein flächendeckendes Netz von Berichterstattern. Das Bild einer Schätzkarte für Obst ist in diesem Link hinterlegt. Zu Zeiten, als noch viele landwirtschaftliche Betriebe ein Standbein in der Gemüseerzeugung hatten und auch der Obstanbau in Streuobstanlagen eine wichtige Rolle spielte, war dieses Netz sinnvoll. Bei der heutigen, hohen Spezialisierung und der regionalen Konzentration der Gemüse- und Obstbaubetriebe ist eine Ertragsermittlung ohne die direkte Befragung der Erzeuger nicht mehr sinnvoll möglich. Es gibt kein flächendeckendes Netz von Obst- und Gemüseerzeugern mehr im Land. Als Folge davon wurde auch das Berichterstatternetz stark ausgedünnt. Vor 20 Jahren gab es noch rund 1000 Obstberichterstatter. Heute sind es noch 190. Die wichtigste Ernteerhebung für Obst ist heute die Apfelsortenstichprobe, bei der rund 250 Apfelerzeuger in Niedersachsen direkt Angaben zu ihren Erträgen machen. Statt einen Ernteberichterstatter die Ernte vieler Erzeuger in einen Berichtsbezirk schätzen zu lassen, werden heute vermehrt die Erträge von einer Auswahl der wenigen verbliebenen Gemüse- und Obstanbauer direkt erfragt und so ein Landesergebnis errechnet. Die klassische Methode der EBE wird von einer Betriebsberichterstattung abgelöst. Die Anbauflächen für Obst und Gemüse steuern die Gemüseanbauerhebung und die Obstanbauerhebung bei.
Wenn das Getreide druschreif geworden ist, kann auf den Feldern mit der Probenahme für das Messverfahren der BEE begonnen werden. Zu dem Zeitpunkt liegen von der EBE schon die ersten Vorschätzungen vor.
Die BEE wird jährlich als "dreistufiges Stichprobenverfahren" für die wichtigsten Getreidearten (in Niedersachsen: Winterweizen, Roggen, Triticale, Wintergerste, Sommergerste) und für Kartoffeln (Speisekartoffeln, Industriekartoffeln) nach exakten Richtlinien durchgeführt. Die BEE hat eine interessante Geschichte.
Als nach dem zweiten Weltkrieg die verbliebenen Westzonen mit Flüchtlingen vollgestopft waren und die Lebensmittellieferungen aus den verlorenen Ostprovinzen fehlten, mussten viele Leute hungern. Die Westalliierten mussten Lebensmittel liefern, wenn sie Westdeutschland als Hauptbarriere gegenüber dem weiteren Vordringen des Kommunismus aufbauen wollten. Die Lebensmittelhilfen waren teuer, England selbst hatte noch die Lebensmittelrationierung. Nun verlangten die Alliierten von der Statistik genaue Auskunft über die eigene Erzeugung in den Westzonen und die Erzeugungsmöglichkeiten. Die Zahlen wurden nach den gesetzlichen Vorgaben vom 8.11.1877 erstellt. Die Ernteeinschätzungen der ausgewählten Berichterstatter waren immer sehr korrekt, bis zum Kriegsende hatte auch das Rationierungssystem, im Unterschied zum ersten Weltkrieg, gut funktioniert. Trotzdem misstrauten die Amerikaner und Engländer diesen Angaben. Sie dachten, dass hier eine Bedürftigkeit vorgetäuscht wird und ließen die in ihren Ländern üblichen, stichprobengestützten Ertragsermittlungsverfahren hier einführen. Bis zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland nur das System der "Erntemeldungen", das damals aber auch schon Probemessungen enthielt.
Mir wurde noch von einem älteren "Bundesprüfer" erzählt, wie in den ersten Jahren nach dem Krieg immer ein englischer Offizier mit zur Überwachung der Probeziehungen und Felderauswahl mit auf die Höfe kam. Das löste doch einiges Erstaunen aus, wenn so ein englischer Offizier mit dem berühmten Stöckchen zu Besuch kam. Das Bundesamt für Ernährung, Frankfurt/Main, sollte mit den "Bundesprüfern" die einheitliche Umsetzung der BEE in allen Ländern kontrollieren. Seit ca. 1988 obliegt dies nur noch den Statistischen Landesämtern selbst.
Die beiden Ernteermittlungsverfahren, das alte mit den Ertragsmeldungen und das neue als statistisches Stichprobenziehungsverfahren, sind heute kostensparend aufeinander abgestimmt. Die EBE enthält keine vorgeschriebenen Probemessungen mehr. Der Anlass der Einführung der stichprobengestützen Messverfahren durch die Alliierten fiel mit steigender Wirtschaftskraft schnell weg. Aber inzwischen wurde das von Wissenschaftlern in den USA auf Basis der statistischen Stichprobentheorie entwickelte Verfahren der Ernteberechnung mehr oder weniger Standard in allen Industrieländern. Die amerikanischen Wissenschaftler waren zu der Zeit in der Theorie der Qualitätssicherung, aus der die Stichprobentheorie entwickelt wurde, führend. Die Japaner kopierten und verfeinerten die Verfahren nach dem zweiten Weltkrieg in ihrer Wirtschaft und waren mit dieser Art der Produktionssteuerung extrem erfolgreich.
Die BEE ist ein Messverfahren. Der Ertrag von vielen Probestellen wird gewogen und hochgerechnet. Über den theoretischen Hintergrund und über praktische Details wird unter dem Punkt 4.3 berichtet.
Zuerst ein grober Überblick, welche Stellen an der BEE für Niedersachsen beteiligt sind:
 |
| Die Waage und der Feuchtigkeitsmesser in der LUFA sind an den PC angeschlossen. Wichtige Daten der Proben zur Ertragsermittlung (Gewicht, Feuchtigkeit) werden per E-Mail an das Stat. Landesamt übermittelt. |
Als "Winterarbeit" wird die Auswahl der Betriebe, der Druck und die Bereitstellung aller benötigten Unterlagen und Materialen, die Besetzung der Kreiskommissionen, die Werbung und Betreuung neuer Kreiskommissionen, die Erstellung der Ergebnis- und Rechenschaftsberichte, erledigt. Bei der praktischen Felderauswahl auf den Betrieben sind Mitarbeiter der BEE ab April im Rahmen von Schulungs- und Auffrischungsmaßnahmen beteiligt. Meist werden dazu die Betriebe aufgesucht, bei denen als Volldruschbetriebe mehr Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Falls das Datenmaterial Lücken enthält (z.B. Fruchtart wird dieses Jahr auf dem Betrieb nicht angebaut), ist es die Aufgabe der Stammmannschaft im Hause, eventuelle Ersatzbetriebe zu losen. Der Einsatz von Mobiltelefonen hat sich hier sehr bewährt und Wegekosten reduziert. Bei den eigentlichen Probeschnitten sind die Mitarbeiter der BEE ebenfalls im Rahmen von Schulungs- und Auffrischungsmaßnahmen, aber auch im Rahmen von Kontrolltätigkeiten, im Einsatz. Bei Volldruschen übernehmen sie die Vermessung der Felder mit schwieriger Geometrie. Die Abstimmung der Arbeitsschritte, die zeitnahe Datenerfassung, Auswertung, Kontrolle und die Abrechnung der Kosten führt in den Ferienmonaten zur höchsten Arbeitsspitze. Nach der Kartoffelernte werden eine Reihe von Auswertungen erstellt, die in den jährlichen Bericht "Besondere Ernteermittlung" des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft einfließen. Im Winter sind in der BEE 1,5 Personen beschäftigt, im Sommerhalbjahr drei. Die EBE beschäftigt 5 Personen. Die Aufgaben werden z.T. gemeinsam erledigt. Im Bundesvergleich dürfte die niedersächsische Erntestatistik sehr effektiv arbeiten.
Die Durchführung der praktischen Arbeiten (siehe Punkt 4.3) auf den Höfen und Feldern der Landwirte liegt meist in der Hand der "Erhebungsbeauftragten". Das sind überwiegend Landwirte, die auf Empfehlung der Kammern oder des Landvolkes vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik geschult und im Rahmen von Werkverträgen verpflichtet und bezahlt werden. Im ganzen Land sind 48 Kommissionen tätig. Eine Kommission besteht aus zwei Erhebungsbeauftragten und zwei Stellvertretern. Die Kommissionsmitglieder erledigen die anfallenden Arbeiten in den Sommermonaten neben ihren eigentlichen Berufen. In anderen Bundesländern werden diese Arbeiten oft noch von den Angestellten oder Beamten der Landwirtschaftsämter oder Kammern im Rahmen der Amtspflichten erledigt. In Niedersachsen wurde diese Praxis vom Landesrechnungshof als für die Kammern aufgabenfremd und zu teuer gerügt und nach Anweisung der politischen Entscheidungsträger daraufhin vom Statistischen Landesamt privatwirtschaftlich organisiert. Der Transport der Probeschnitte in die Lufa wurde ebenfalls mit Hilfe von Logistikunternehmen privatisiert. Der Organisationsaufwand für das Statistische Landesamt ist dadurch etwas höher geworden, die Gesamtkosten für den niedersächsischen Steuerzahler schrumpften.
 |
| Bei der Besatz- und Auswuchsprüfung in Hameln wird jedes Korn einer Unterstichprobe auf einem Leuchttisch angeschaut. |
Die von den Kreiskommissionen eingehenden Säcke mit den Getreideprobeschnitten (Stroh und Ähren) werden in der LUFA (Landwirtschaftliche Forschungs- und Untersuchungsanstalt) auf einer Standdreschmaschine sauber ausgedroschen. Die Körner kommen dann in verschlossenen Säckchen (1,5 bis 5,5 kg/Säckchen je nach Ertrag) sofort ins Labor.
Dort wird die Feuchtigkeit gemessen und das Gewicht festgestellt. Die Daten werden dem Statistischen Landesamt sofort übermittelt. Aus den Daten wird laufend der Trend beim Landes- Hektarertrag beobachtet. Die Proben werden im Trockenschrank auf 14% getrocknet und bis zum Abschluss aller Arbeiten archiviert. Von allen Weizenprobeschnitten schickt die LUFA je eine gekennzeichnete Probe von mindestens 400g nach Detmold zur Beschaffenheitsuntersuchung.
Von allen Volldruschen erhält die LUFA zusätzlich eine Korn- Mischprobe aus dem Korntank des Mähdreschers oder vom Wagen. Die Probe entnimmt die Kreiskommission und füllt sie in eine ca. 1 kg fassende, fest verschließbare Dose. Diese Probe unterläuft im Labor der LUFA der gleichen Behandlung wie die Körner aus den selbst gedroschenen Probeschnitten, zusätzlich wird hier noch der Schwarz- und Fremdbesatz sowie der Auswuchs (gekeimte Körner) ermittelt.
 |
| Ausdreschen der Probe auf der Standdreschmaschine |
 |
| Abfüllen der Kornproben, Beschriftung der Säckchen, ab ins Labor |
Die Aufgabe der Forschungsanstalt im Rahmen der BEE ist es, die Beschaffenheit der deutschen Weizen- und Roggenernte (Brotgetreidearten) zu ermitteln. Damit ist sowohl die Backqualität (bei Weizen: Schmachtkornanteil, Auswuchs, Aschegehalt, Fallzahl, evtl. Klebermenge, Proteingehalt, Sedimentationswert und evtl. das Hektolitergewicht) als auch die Gesundheit (Schadstoffanalyse) der Ernte gemeint. Sie erhält dazu aus ganz Deutschland von den Weizen- und Roggenvolldruschfeldern per Post Kornproben in ca. 2 kg fassenden Säckchen sowie 400g schwere Körnerproben von den bei den LUFA's gedroschenen Weizen- Probeschnitten. Neuerdings erhält die Forschungsanstalt jährlich wechselnd auch von jeweils einer anderen Getreideart der BEE- Volldrusche eine 500g Probe vom Feld. 2001 wurde so Triticale zusätzlich beprobt. Es wird ein Gesamtergebnis festgestellt, die einzelnen Proben sind anomymisiert.
Die Ergebnisse der Qualitätsuntersuchungen können mit anderen Ergebnissen der BEE und Anbau- und Erntestatistik 2002 genauer im Internet betrachtet werden:
Die Mahl- und Backqualitäten des Weizen 2002: http://www.bagkf.de/BEE_2002_Weizen_01.pdf
(Seite der Bundesforschungsanstalt in Detmold; Neues Fenster wird geöffnet, mit dem "X"- Lösch-Knopf kommen Sie wieder zurück.)
Die Qualitäten der Roggenernte 2002: http://www.bagkf.de/BEE_2002_Roggen.pdf
(Neues Fenster wird geöffnet, mit dem "X"- Lösch-Knopf kommen Sie wieder zurück.)
Auch die Untersuchung auf gesundheitsgefährdende Stoffe ist keine Kontrolle irgendeiner Partie oder eines Landwirtes, die Proben könnten auch nur bis auf Kreisebene zurückverfolgt werden, sondern dient der allgemeinen Lebensmittelsicherheit. Falls sich Grenzwertprobleme mit pilzlichen Krankheiten, chemischen Rückständen oder Schwermetallen abzeichnen würden, kann so frühzeitig gegengelenkt werden. Der gesamte Getreidebereich blieb bisher auf diese geräuschlose Weise von Lebensmittelskandalen verschont.
Ein "dreistufiges Stichprobenverfahren" meint, dass erst bei der dritten Zufallsauswahl eine vorher berechnete Auswahlmenge von Merkmalsträger untersucht wird. Die theoretischen Grundlagen sind übrigens immer die gleichen, egal ob man damit z. B. den durchschnittlichen Hektarertrag einer riesigen Fläche, die durchschnittliche Jahreslaufleistung von PKW´s oder den durchschnittlichen Füllungsgrad von Joghurtbechern ermitteln will. Es genügt natürlich nicht, ein einziges Teil zu messen und dann groß zu verkünden: "So wird die Ernte!". Das ist aus statistischer Sicht selbst bei sehr homogenen Teilen unseriös. Um zum durchschnittlichen Hektarertrag einer auf viele Bauernhöfe und noch mehr Felder verteilten, sehr unterschiedlichen Frucht zu kommen, muss zuerst der Stichprobenumfang nach bestimmten Vorgaben berechnet werden. Die Frage ist immer, wie groß die Stichprobe sein muß, um zu wie hoch gesicherten (95% und mehr) Aussagen zu kommen. Dann geht es an die praktische Stichprobenziehung. Dazu müssen:
ausgelost werden. Das sind die drei Stufen der Auswahl. Ganze Stücke von einem ganzen Hektar auszuwählen und zu dreschen, wäre übertrieben. Es genügt, viele einen Quadratmeter große Stücke zufällig über die ganzen Anbauflächen im Land verteilt auszuwählen, den Ertrag auf diesen Quadratmeterstücken zu ermitteln und dann den Durchschnitt zu bilden. In Niedersachsen werden so Jahr für Jahr 6400 über das ganze Land verteilte Proben entnommen. Wie diese Auswahl auf den drei Stufen praktisch erfolgt, wird in den drei folgenden Punkten geschildert.
In der ersten Auswahlstufe werden die für jede Getreideart festgelegte Anzahl von Stichprobenbetrieben repräsentativ (d.h. nach dem Zufallsprinzip) ausgelost. Wesentlich hierbei ist, dass die Auswahl der Betriebe und Felder für jede Fruchtart getrennt und proportional zu ihrer Anbaufläche erfolgt. Sehr große Betriebe können deswegen fast jährlich mit einer oder zwei Getreidearten und Kartoffeln in dieses Stichprobenverfahren fallen. Als Auswahlgrundlage zur Ermittlung der Betriebe diente in den Zeiten vor den PC-Datenbanken eine Auflistung aller Flächen, "Kumulierte Reihe" genannt. In einem kiloschweren, gefalteten Papierstapel waren die Anbauflächen aller Betriebe aus der jeweils letzten totalen Bodennutzungshaupterhebung aufgelistet (Details erwünscht?). Nach der Auswahl bekommen nur die direkt betroffenen Kreiskommissionen die Anschriften der ausgewählten Betriebe in Ihrem Aufgabenpaket mitgeteilt. In den jedes Jahr neu aufgelegten Richtlinien zur BEE in Niedersachsen werden nur die Gemeinden und Ortsteile, in denen die ausgewählten Betriebe zu finden sind, nach Kreiskommissionen geordnet, übertragen.
In der Auswahlstufe zwei wird der ermittelte Betrieb besucht und das zu beprobende Feld auf dem Betrieb ausgelost. Nach dem Agrarstatistikgesetz können höchstens 14000 Felder im Bundesgebiet beprobt werden. In Niedersachsen wurde im Jahr 2001 insgesamt 1280 Felder ausgelost, davon 280 Wintergerstenfelder, 230 mit Winterweizen, 210 Roggen, 170 Sommergerste, 170 Triticale, 120 Industriekartoffeln und 100 Speisekartoffelfelder. Die Zahl der auszuwählenden Probefelder wird nach mathematisch- statistischen Grundsätzen so vorgenommen, dass die Summe der Probefelder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Gesamtheit aller Felder im Land und somit auch den Landesertrag widerspiegelt (Details erwünscht?).
In der dritten Stufe werden auf dem Probefeld jeweils kurz vor Erntebeginn die Probeschnitte ausgewählt, geschnitten und eingesammelt. Dabei wird je Feld von den fünf verschiedenen Probestellen, die nach einem fest vorgeschriebenen Schema ausgewählt werden müssen, aller Aufwuchs abgeschnitten, in einen Jutesack gesteckt und zur LUFA nach Hameln geschickt. Dort wird der Aufwuchs ausgedroschen und die Körner gesichtet und gewogen (Details erwünscht?). Was dann in der LUFA geschieht, wurde in Punkt 4.2.3 beschrieben.
 |
| Eine Kreiskommission bei der Probenahme-Schulung. Mit dem Metallrahmen werden die Probestücke abgegrenzt. |
Eine häufige Irritation bei den Kreiskommissionen und den Landwirten tritt dann auf, wenn ein Probeschnitt nach den strengen Auswahlvorschriften nun genau in eine Fehlstelle des Feldes fällt und die Kreiskommission nun hauptsächlich Unkraut in den Sack steckt. Die Abweichung zwischen dem Probeschnittertrag des Feldes und dem Ertrag des Volldrusches ist dann natürlich entsprechend hoch. Die Kommissionsmitglieder und interessierte Landwirte machen einem als Ortsfremden aus der Landeshauptstadt manchmal tolle Vorschläge, wie man denn die fünf Probestellen verteilen könnte, damit man in etwa den Durchschnittsertrag des Feldes erwischt. Es fällt etwas schwer zu erklären, dass man nach der Stichprobentheorie mit den Probestellen gar nicht herausfinden will, wie hoch der Ertrag ihres Feldes ist, sondern diese fünf Probestellen in dem Feld nur ein Teil der z.B. 1150 über das gesamte Land verteilten Quadratmeterproben sind. Uns interessiert ja nur der Landesertrag und dazu müssen wir diese 1150 Proben nach einem starren Muster auf alle mit der Fruchtart bestellte Flächen fallen lassen. Da kann nicht ein paar Meter hin- oder her geschummelt werden. Fehlstellen treten überall mal auf und werden so insgesamt berücksichtigt.
Dieses Missverständnis wird oft noch verstärkt durch einen Service, den wir interessierten Landwirten als Dank für ihr Interesse anbieten. Sie bekommen den von uns ermittelten Probeschnittertrag ihres Feldes per Mail oder Post mitgeteilt. Zugleich auch einen Hinweis, dass dies nicht exakt mit den gedroschenen Erträgen übereinstimmen muss. Besonders junge Landwirte sind an den Vorgängen auf ihren Feldern manchmal sehr interessiert und es erleichtert die Arbeit und die Freude an der Arbeit doch sehr, wenn ein gewisses partnerschaftliches Verhältnis aufgebaut werden kann. Dem dient auch dieser Artikel. Die amtliche Statistik funktioniert hier durchaus nicht mehr nur als "Informationseinbahnstraße". Auch wenn für die BEE eine gesetzliche Auskunftspflicht besteht, ist es einfacher, angenehmer und billiger, mit gut informierten Landwirten zusammen zu arbeiten.
 |
| BEE-Mitarbeiterin beim Feldervermessen mittels satellitengestützter DGPS-Technik im Weserbergland |
In der dritten Stufe des vorigen Absatzes wurde beschrieben, wie die Quadratmeter-Proben innerhalb eines Feldes ermittelt und geschnitten werden. Hier wird sozusagen jedes Korn, das auf diesem Quadratmeter zu finden ist, aufgesammelt. Aber keine Ernte ist völlig verlustfrei. Manche auf dem Boden liegende Ähren können vom Mähdrescher nicht erfasst werden. Kein Mähdrescher oder Roder arbeitet völlig verlustfrei. Jeder Fahrer ermittelt automatisch einen Kompromiss zwischen Arbeitsgeschwindigkeit, Bruchkornanteil und Kornverlusten, wenn er ein Feld mäht. Um Feldverluste bestimmen zu können, ist jedes sechste Probeschnittfeld nun zusätzlich für die sogenannten Volldrusche vorgesehen. Statistisch ausgedrückt handelt es sich um eine 16,7%-Unterstichprobe aus der zweiten Auswahlstufe. In Niedersachen fielen 2001 insgesamt 178 Getreide- Probeschnittfelder zusätzlich in die Volldruschproben.
Der Landwirt wird bei einem Volldruschfeld gebeten, das Erntegut des ganzen Feldes zu verwiegen (Fahrzeugwaagen oder Durchlaufwaagen). Die reinen Wiegekosten (z.B. bei einem Lagerhaus, Kieswerk etc.) werden erstattet. Die Schlaggröße wird von den Kreiskommissionen ermittelt. Bei schwieriger Geometrie des Feldes wird dazu ein DGPS-Gerät (Differential Global Positioning System) mit Satellitenortung verwendet. Mit diesem Gerät im Rucksack wird ein Feld umschritten und auf Knopfdruck bekommt man die tatsächliche Größe des gemähten Feldes. Dies war eine erhebliche Kosteneinsparung gegenüber den Vermessungen durch Trupps der Ämter für Agrarstruktur. Die Mitarbeiter der niedersächsischen Erntestatistik halten sich über die nutzbringenden Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien stets auf dem Laufenden.
 |
| Das Feld wird umlaufen und die Probemessungen ergeben einen Flächenwert, der in einen PC übertragen wird. |
Die auf diese Weise berechenbaren Abweichungen zwischen dem durch die Probeschnitte ermittelten gewachsenen Erträgen der Felder und dem durch die Volldrusche bekannten, tatsächlich geernteten Erträgen (ohne Ernteverluste, Randverluste), dienen der Korrektur aller Probeschnitterträge. Die Abweichungen werden über eine mathematisch-statistische Berechnungsmethode bewertet und es wird der endgültige Landesdurchschnittsertrag ermittelt.
Die Probenehmer der Kreiskommissionen sind beim Dreschen des Feldes kurz anwesend und entnehmen aus dem Korntank des Mähdreschers eine Probe, bei Weizen und Roggen zwei Proben. Eine Probe geht immer zur LUFA, die zweite bei Weizen und Roggen nach Detmold. Die Daten werden im Volldruschnachweisblatt festgehalten. Von allen Volldruschfeldern Deutschlands werden Proben an die Bundesforschungsanstalt für Mehlforschung nach Detmold geschickt. Hieraus wird u. a. die Qualität der deutschen Weizen- und Roggenernte festgestellt.
In den Kartoffelfeldern wird ähnlich wie in den Getreidefeldern vorgegangen, nur dass hier an fünf Stellen im Feld jeweils ein 5 m langes Dammstück per Hand gerodet wird (Auswahlplan). Zusätzlich wird dann noch der durchschnittliche Reihenabstand benötigt, um auf die Probestellengröße und den Feldertrag zu kommen. Auf Nachrodungen ganzer Felder wird aus Kostengründen und wegen der immer wieder festgestellten, relativ konstanten Abweichungen zwischen den Proberodungen und Vollrodungen verzichtet. Als absolut größtes Kartoffelerzeugerland werden in Niedersachsen schon seit fast zehn Jahren die Proberodungen getrennt für die Speisekartoffeln und die Kartoffeln für die industrielle Verarbeitung durchgeführt.
Nun mag die Erstellung von Erntestatistiken für einen wirtschaftlichen Überblick sinnvoll und die Methoden ausreichend genau sein, aber man kann ja auch fragen, ob es nicht unter Nutzung neuer Techniken oder Datenbestände vielleicht einfacher, billiger, genauer ginge. Gesetzliche Grundlagen und einmal erstellte Richtlinien verleiten dazu, sich auf diesen Vorschriften auszuruhen und Verbesserungsmöglichkeiten zu verschlafen. Es gibt ja keine Konkurrenz, die einem das Geschäft abnehmen könnte. Hier sind einige Entwicklungen, die die Erntestatistiken verändern könnten.
Jeder andere Wirtschaftszweig außerhalb der Landwirtschaft liefert seine Produktionsdaten an die Statistik durch einen Blick in die Buchhaltung. Zum Zeitpunkt des ersten Erntestatistikgesetzes 1877 hatten die meisten Landwirte noch keine Buchführung. Das wäre also gar nicht möglich gewesen. Auch heute haben viele Landwirte noch keine Buchführung (ca. 65% in der Ex-BRD, 50% in Niedersachsen, 40% in den neuen Bundesländern laut Landwirtschaftszählung 1999), aber dieser Anteil nimmt mit steigenden Betriebsgrößen stetig ab. Die Ergebnisse aus den Buchführungsbetrieben stimmen gut mit den Ertragsermittlungen der Statistik überein, vgl. Grafik für Getreide im Kammergebiet Hannover. Aber die Erntedaten sollten möglichst zeitnah zur Ernte vorliegen und von zuverlässigen Prognosen vorbereitet werden. Buchführungsergebnisse aus der aktuellen Ernte liegen im Schnitt 15 Monate nach der Ernte vor.
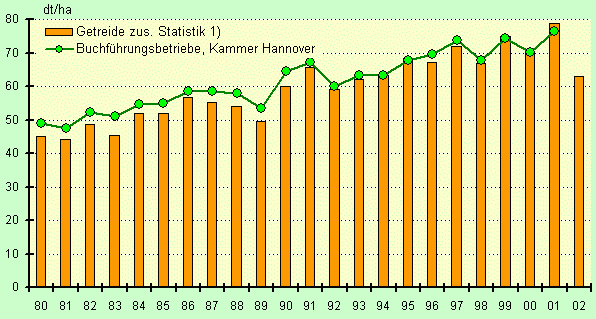 |
| Vergleich der Getreideerträge (ohne Körnermais) zwischen der Statistik und den Buchführungsbetrieben, Kammergebiet Hannover |
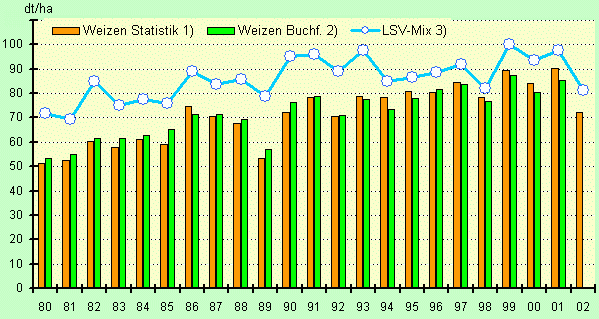 |
| Vergleich der Weizenerträge zwischen der Statistik, den mittelerfolgreichen Buchführungsbetrieben und den Landessortenversuchen (LSV), Kammergebiet Hannover 1) Winterweizen, 2) Weizen zusammen (geringer Sommerweizenanteil), 3) Winterweizensorten- gewichtete Mittelwerte aus allen Behandlungsstufen aller Standorte. Die Erträge der Landesortenversuche (LSV) der Kammern liegen über den Praxiserträgen. Bei den LSV gibt es durch unterschiedliche Untersuchungsmerkmale in der Zeitreihe methodische Sprünge. Die Grafik soll nur Größenordnungen zeigen. |
Es wurde immer wieder getestet, ob man nicht durch eine zeitnahe Befragung einer Stichprobe von Landwirten zu ihrer aktuellen Ernte die Erträge so schnell und zuverlässig wie mit der BO, der EBE und der BEE ermitteln kann. Die Auskünfte, Einsparmöglichkeiten und Ergebnisse waren bisher bei Feldfrüchten und Grünland nicht immer überzeugend. Nun kann für Feldfrüchte und Grünland wegen des flächendeckenden Anbaues ein flächendeckendes Berichterstatternetz gut aufrechterhalten werden, so daß sich der Zwang zu direkten Befragungen einer Stichprobe von Erzeugern, womöglich noch mit einer Auskunftspflicht und dem ganzen Verwaltungsaufwand dazu, nicht ergibt. In der Obst- und Gemüseernteberichterstattung wurde wegen der Konzentration auf wenige Erzeuger und Gebiete in Niedersachsen schon stark auf eine direkte Befragung der Betriebe, meist in Form von Werbungen als Berichterstatter, übergegangen. In Schleswig-Holstein mit seinen relativ wenigen und großen Betrieben gibt es nur noch eine "Betriebsberichterstattung". Die Ernteberichterstatter geben nur noch den Ertrag für ihren Betrieb an. Je weniger Landwirte es noch in einem Berichtsbezirk gibt, um so eher kann man mit einem Durchschnittsbetrieb arbeiten. Der Nachteil könnte der sein, dass vor allem leistungsstarke Betriebe am ehesten für eine solche Aufgabe zu gewinnen sind und man deshalb relativ hohe Meldungen bekommt.
Weshalb manche Landwirte Vorbehalte gegen Ertragsmeldungen haben, ist manchmal schwer zu ermitteln. Sätze wie: "die Statistik dient nur zur Planung von Billigimporten, zur Information der Lagerhäuser und zur Zerstörung der deutschen Landwirte" sind noch recht verbreitet. Mancher Landwirt hat noch romantische Vorstellungen von der einfachen, staatsgelenkten "Bedarfsdeckungswirtschaft", die von 1933 bis 1945 jedem Landmann als heilsbringend vorgeschwindelt wurde. Der Staat hatte demnach die Aufgabe, große Vorräte anzulegen und immer nur so viel Importe in das Land zu lassen, wie zur kontinuierlichen Versorgung der Bevölkerung mit den für nötig erachteten Lebensmitteln gebraucht wird. Der Staat sorgt für eine verständliche Gerechtigkeit. Dass Deutschland heute schon längst ein Getreide, Milch und z. T. Fleisch exportierendes Land geworden ist, haben manche, trotz aller Getreideberge und Milchseeen Ende der 80er Jahre, einfach ignoriert oder behaupten schlicht das Gegenteil. Wir brauchen Kunden auf dem Weltmarkt für unser Getreide, könnten es niemals alleine essen oder verfüttern! Wegen der seit Kriegsende mehr als verdreifachten Hektarerträge muss gerade Niedersachsen, trotz kleinerer Anbaufläche als Bayern der größte Getreideproduzent, Getreide exportieren. Im Jahr 2000 exportierte Deutschland 14,0 Mio. Tonnen Getreide und importierte 3,4 Mio. Tonnen. Niedersachsen profitiert hier von seinen Seehäfen. Wichtige Kunden sind die bevölkerungsreichen arabischen Staaten. Wer will denn heute noch den Import von Südfrüchten, Obst, Reis und Gemüsearten (die großen Defizitbringer der Nahrungsmittel Import-Exportbilanz) verbieten, damit "die Leute" wieder mehr deutsche Erzeugnisse essen müssen? Der Wohlstand Deutschlands, auch der der Landwirte, beruht auf einem relativ gut geregelten Warenverkehr mit dem Ausland. Der Erfolg einer Volkswirtschaft wie von Unternehmen beruht auch in dem Erkennen und Auswerten von verlässlichen Informationen. Mit Tricks und Täuschungen läßt sich heute niemand, kein Nachbarland, kein Lagerhaus, kein Spekulant, keine Mühle, kein Nachbar, kein Konkurrent auf dem Weltmarkt mehr lange hinter´s Licht führen. Das würde grandios schief gehen.
Ihre Anbauflächen müssen viele Landwirte zwei staatlichen Stellen melden. Die zweite Stelle sind die Kammern, bzw. Landwirtschaftsämter. Die Bodennutzungshaupterhebung erfasst z.T. die gleichen Merkmale, wie sie seit der EU- Agrarreform von 1992 für die EU im Rahmen der damals eingeführten Ausgleichszahlungen (Hektarprämien) erfasst werden. Die Erzeugerpreise für Getreide wurden damals drastisch (rund 50%) gesenkt und als Ausgleich wurden Hektarprämien für den Getreideanbau eingeführt, daher kommt der Begriff "Ausgleichszahlungen". Seit dem können fast alle Landwirte in der EG einen "Antrag auf Agrarförderung" bei den Kammern oder Landwirtschaftsämtern abgeben. Darin sind auch die Anbauflächen aufgeführt. Ab dem Jahr 2005 plant die EU, die Feldstücke in diesen Anträgen nicht nur mit den Katasterangaben zu vergleichen und erfassen zu lassen, sondern auch mit georeferenzierten Daten zur leichteren Fernerkennung (Verordnung VO(EWG) Nr. 3508/92 Artikel 13). So kann über Satellit eine für alle EU-Staaten, auch für die mit weniger umfangreichem Katasterwesen, brauchbare Kontrolle der Angaben auf den Anträgen erfolgen. Das Vorliegen von georeferenzierten Felddaten über den Anbau ab 2005 wäre für die BEE eine theoretische Möglichkeit, die Auswahlstufen eins und zwei zu rationalisieren.
Für die Landwirte ist es ärgerlich, dass sie für zwei staatliche Stellen die Nutzung ihrer Flächen parallel angeben müssen. Das Statistische Landesamt schickt einen Erheber vorbei und bei den Kammern sind die Flächennutzungen im Rahmen der Anträge auf Agrarförderung abzugeben. Das ist schwer zu rechtfertigen, denn die Bevölkerung macht keine spitzfindigen Unterschiede zwischen den Ämtern, aber es ist auch zu rechtfertigen. Andere Länder haben versucht dies zu vermeiden. In Bayern z.B. können BO- Angaben aus den Anträgen auf Agrarförderung (in Bayern: "Mehrfachantrag") übernommen werden. Per Datenleitung werden die Flächen von den Landwirtschaftsämtern zum Stat. Landesamt in München überspielt. Das Stat. Landesamt erfragt nur noch die über den Mehrfachantrag hinausgehenden Daten bei den Landwirten. Die Daten von rund 98% der Landwirtschaftlichen Fläche und 91% der Betriebe stammen schon aus den Mehrfachanträgen. Im Unterschied zu Niedersachsen ist es in Bayern immer stark üblich gewesen, dass die Landwirte "auf die Gemeinde" bestellt werden, während in Niedersachsen meist von der Gemeinde beauftragte Personen zum Interview sich anmelden und auf die Höfe kommen. Das Ziel der Entlastung der Landwirte von überflüssigen, ungeliebten Doppelangaben hat das Pilotprojekt in Bayern erreicht.
Mit den Fragebögen zur Bodennutzung werden in Niedersachsen zugleich einige andere Fragebögen zu verschiedenen Statistiken (Arbeitskräfte, EG- Agrarstrukturerhebung, Feststellung der betrieblichen Einheiten) zusammen erfasst ("Integrierte Erhebung"). Würden diese Angaben zusammen mit dem Antrag auf Agrarförderung nur von den Kammern erhoben und an das Stat. Landesamt überspielt, stiege die Belastung der Kammern, was den in Niedersachsen selbstverwalteten Kammern nicht egal wäre. Wie man diese Probleme organisatorisch lösen könnte wird abgewogen so lange es diese Anträge auf Agrarförderung nun mal gibt. Die Aufspaltung von Erhebungen und des Erhebungsweges (Kammern, direkter Postweg, Gemeinden) führt regelmäßig zu schwierigen Detailproblemen beim Trennen und Zusammenführen der Berichtskreise. Es wird in den Ländern verschieden gehandhabt. Ein Land erwägt auch wieder eine Rückkehr zu einem einheitlichem Erhebungsweg. Das Ziel der Verminderung der Belastung der Landwirte und einer Ausschöpfung von Einsparungsmöglichkeiten muß immer verfolgt werden.
Insgesamt ist die jetzige Befragungs- und Datengewinnungsdiskussion sehr rückwärtsgewandt, denn die Zukunft gehört natürlich den Online-Erhebungen. Die Ausstattung der Landwirte mit Internetanschlüssen im modernen Agrarland Niedersachsen ist überdurchschnittlich gut. Es müsste noch eine gewisse Zeit mit Übergangslösungen, Online-Katalog und Papierbogen nebeneinander, gearbeitet werden. Ein Landwirt müsste auch per Link entscheiden können, ob er Daten aus dem Online-Agrarförderungsantrag auch für die Statistik nutzen will und so nur noch die über die Agarförderung hinausgehenden Fragen gestellt bekommt. Falls einmal die Agrarförderanträge in der heutigen Form wegfallen sollten, könnte der Erhebungsweg in einem solchen System sehr variabel gehalten werden. Leider kann diese Technik noch nicht genutzt werden. Besonders schwierig sind anscheinend die Probleme der sicheren Datenleitung, des sicheren Empfangs, der Anpassung der EDV-Systeme und Ausstattungen, der Flexibilisierung aller Bearbeitungsstufen.
Sind die Erkennungsmöglichkeiten über Satellit schon so genau, dass man darauf wenigstens die Früchte auf den Feldern identifizieren kann? Dann könnten die Anbauflächen eines Landes per Luftaufnahmen aufsummiert werden. Dies beträfe die Zukunft der Bodennutzungshaupterhebung. Kartoffeln lassen sich gut vom Mais unterscheiden, auch aus großer Höhe. Aber im Mai den Hafer vom Weizen unterscheiden? Das ist schon für den Landwirt mit dem Auge über dem Bestand nicht mehr so gewiss zu schaffen. Auch bei gröberen Erkennungsmuster ist es bisher nicht möglich, die Früchte mit ausreichender Genauigkeit aus der Höhe zu identifizieren. So stellte sich z.B. bei Tests der merkwürdige Weinbau im Schwarzwald als Buchenschonung heraus. Viele Wissenschaftler haben alle paar Jahre mit Hilfe der jeweils neuesten Technik versucht, immer bessere Erkennungsmodelle zu entwickeln. Für die Erntestatistik wäre es egal, woher und wie sie bis zum Erntebeginn ihre Flächen bekäme, Hauptsache die Summen sind ausreichend zuverlässig.
Den Ertrag eines Feldes einfach mittels per Luftaufnahmen gewonnener Farbstufenanalysen etc. zu berechnen, war bisher nicht recht überzeugend. Man braucht dazu genaue Referenzfelder auf dem Boden. Bei witterungsbedingten Abweichungen, und die gibt es fast jedes Jahr, versagen alle gespeicherten Erfahrungswerte. Letztendlich müssten wohl so viele Referenzfelder auf dem Boden beprobt und ständig beobachtet werden, dass es gegenüber der Besonderen Ernteermittlung wohl kaum zu einer Einsparung kommen würde. Wie geschätzt trotzdem auch grobe Erntezahlen sind, zeigte zu Zeiten des "Kalten Krieges" das Interesse des Landwirtschaftsattachés der amerikanischen Botschaft in Bonn an den Erntezahlen aus Niedersachsen. Damit wurden auch Programme zur Satellitenbilderauswertung über der Sowjetunion gespeist, um die Ernte jenseits der Mauer zu schätzen und als grobe Ernteprognosen für die UdSSR zu veröffentlichen.
Dass bisher noch nichts Besseres und Billigeres als die bestehenden Verfahren zur Ernteermittlung gefunden wurde, heißt natürlich nicht, dass das in alle Zukunft so bleiben wird. Die Entwicklung der Techniken des "Precision Farming" auf Basis georeferenzierten Daten über die Felder wird das bisherige Berechnungsverfahren eines Tages stark verändern. Wenn es möglich wird, über eine Datenbank eine Zufallsauswahl von Schlägen und Feldstücken zu ziehen und mit Hilfe von präzise das Erntegewicht messenden, satellitengesteuerten Mähdreschern und Rodern eben diese Probestellen zu messen oder Felddaten aus GIS-Schlagdateien zu nutzen, wird das bisherige Verfahren der amtlichen Ernteermittlung für diese Mähdrusch- und Rodefrüchte angepasst werden müssen. GIS (Geographische Informationssysteme) verfügen über die Möglichkeit Sach- und Geometriedaten zu erfassen und zu verwalten.
Diese ganze Entwicklung wird aufmerksam verfolgt.
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über Anbau und Ernte 2001 und 2000 in Niedersachsen.
Die Bodennutzung der Betriebe 2001 und 2000 im Land und den Landwirtschaftskammern
Anbauflächen, Hektarerträge, Erntemengen der wichtigsten Feldfrüchte 2000 und 2001
Hektarerträge in Kreisen und Gebieten 2001, Getreide 1
Hektarerträge in Kreisen und Gebieten 2001, Getreide zus., Kartoffeln, Zuckerrüben
Hektarerträge in Kreisen und Gebieten 2001, Raps, Silomais, Grünland
Niedersächsisches Landesamt für Statistik (NLS),
Dezernat 34, Georg Keckl, Tel.: 0511 9898 3441, Fax 4344
E-Mail: georg.keckl@nls.niedersachsen.de
Georg Keckl